Von Dorsch bis SchwuZ: Das war’s
Wovon wir uns 2025 verabschieden mussten
Von Jan Ole Arps, Sebastian Bähr, Hêlîn Dirik, Paul Dziedzic, Lene Kempe, Tarek Shukrallah, Guido Speckmann und Johannes Tesfai

Das Modem
»Piep-piep-tüü-drr-düü-dii-duu-dii-schrrrrr«, dieser Sound signalisierte in den 1990er Jahren den Eintritt in die Cyberwelt. Das Einwählmodem (kurz: Modem), deshalb so genannt, weil man sich über eine Telefonleitung einwählte, läutete damals das Informationszeitalter ein. Im September 2025 stellte der früher größte Internetanbieter, AOL, nach über 30 Jahren das Dial-Up-System in den USA ein.
Hach, das Modem, da kommen Erinnerungen auf, an simplere Zeiten, einerseits. Oder auch nervigere, denn telefonieren und surfen, das ging seinerzeit nicht gleichzeitig. Für einige Familien war das eine konflikthafte Aushandlung. Auch die Geschwindigkeit war damals eine andere, viel Zeit verging zum Beispiel damit, ein Bild dabei zu beobachten, wie es sich vor einem aufbaute. Heute funktioniert beides kabellos und blitzschnell über ein Gerät, das wir ständig bei uns tragen.
Die Rückschau auf die Zeiten des Modems verdeutlicht abermals, wie schwindelerregend die Entwicklung des Internets innerhalb von nur einer Generation gewesen ist. Simplere Zeiten waren es, weil mit der Zunahme von Bandbreite und Geschwindigkeit auch die Informationsdichte zugenommen hat. Informationen, die durch Funk, Fernsehen und Zeitung noch kuratiert wurden, haben vielfältigere Kanäle gefunden. Das hat durchaus auch emanzipatorische Vorteile.
An alle, die sich damals eingewählt haben: Glückwunsch und willkommen im Klub der wandelnden Museen des Internets! Übrigens: In einigen, sehr ländlichen Gegenden und in Institutionen, die aus vielerlei Gründen kein Update durchführen konnten (aka Behörden, denen seit den 1990er Jahren kein Budget mehr für IT-Infrastruktur bereitgestellt wurde), ist das Modem noch weiterhin in Gebrauch. AOL mag die Leistung abschalten, andere aber bieten sie weiter an. Es ist also nicht das endgültige Ende des Modems. Irgendwo, im Keller einer deutschen Behörde, hält ein Modem-Anschluss wahrscheinlich gerade eine überlebenswichtige Aufgabe des öffentlichen Dienstes tapfer aufrecht.
Dorsch in der Ostsee
»Den Dorsch haben wir verloren.« So fasst der Meeresbiologe Rainer Froese vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Geomar die düstere Lage in der Ostsee zusammen. Ein vollständiger Fangstopp für ein, besser mehrere Jahre müsse her, sonst werde sich die durch Überfischung und steigende Wassertemperaturen strapazierte Population nicht mehr erholen, warnt er.
Der Dorsch, der vor allem in Nord- und Ostsee und im Nordatlantik zu Hause ist und außerhalb der Ostsee Kabeljau heißt, ist ein besonderer Fisch. Zunächst mal ist er schön: »Ostseeleopard« wird er wegen seiner schillernden, meist goldbraunen Flecken genannt. Den Rücken des Jägers mit dem großen Kopf zieren drei sportliche Flossen. Einen Bart hat er auch noch. Wegen seines köstlichen Geschmacks, des geringen Fett-, aber hohen Proteinanteils und seiner getrocknet hervorragenden Haltbarkeit ist der Dorsch seit Jahrhunderten eine beliebte Fischer*innenbeute. Manche Länder haben Nationalgerichte mit Dorsch/Kabeljau, der getrocknete portugiesische Stockfisch Bacalhau ist so ein Beispiel. Zwischen Island und Großbritannien hätte es beinah mal einen Krieg um den Dorsch gegeben. Zumindest diese Gefahr ist in der Ostsee nun gebannt.
Den Dorsch zum Aussterben zu bringen, das muss man erst mal schaffen, denn er vermehrt sich eigentlich rasant: Mehrere Millionen Eier legt ein Weibchen – wenn es denn dazu kommt: Dorsche werden erst mit drei bis vier Jahren geschlechtsreif, die meisten werden gefangen, bevor sie sich fortpflanzen können. Hinzu kommt: Schleppnetze haben Laichgebiete zerstört, das Meer ist überdüngt, der Sauerstoffgehalt sinkt, die Wassertemperatur steigt. Das stresst den Dorsch, aber hilft der Sprotte. Die steht zwar auf dem Speiseplan der Ostseedorsche, aber frisst im Erwachsenenalter auch gern die Eier ihres Jägers.
»Wir machen so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann in der Ostsee«, resümierte Fischereiforscher Froese Ende Oktober. Er sollte Recht behalten: Die EU-Staaten beschlossen dieses Jahr keinen Fangstopp, nicht mal eine Senkung der Fangquote. Das war es dann wohl mit dem Dorsch in der Ostsee.
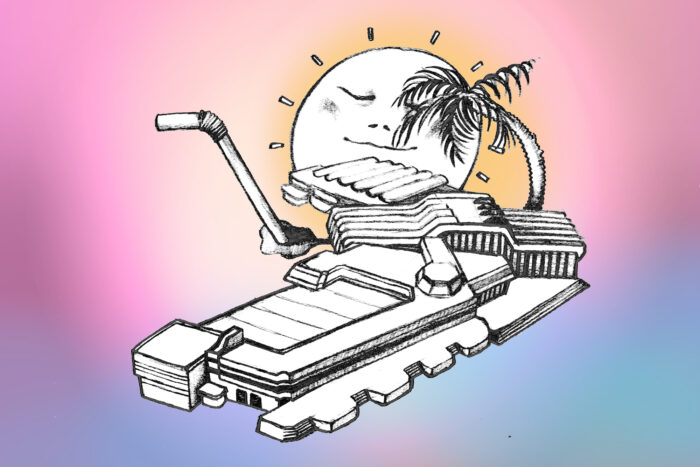
Sport- und Erholungszentrum (SEZ)
»Warum verschwindet alles, das uns mal guttat?«, fragt mich Susanne Lorenz. Die 50-jährige Psychologin steht am Zaun vor dem Sport- und Erholungszentrum (SEZ) im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Sie schaut auf den opulenten Gebäudekomplex, der bald nur noch Schutt sein soll – und ist traurig und wütend zugleich. Als Kind war sie selbst hier planschen – ihre eigene Tochter wird die Möglichkeit wohl nicht mehr haben.
1981 eröffnete die DDR das SEZ – ein futuristisch anmutendes Spaßbad mit Glasfassaden, Wellenmaschine, Eisbahn, Billard, Sauna und Palmen. Ein Ort, an dem man für ein paar Mark Urlaub vom Alltag machen konnte. Ein »utopischer Überschuss«, der den sonst manchmal grauen Realsozialismus bunter schimmern ließ. Nach der Wende dann der große Kater: Der Betrieb wurde heruntergefahren, 2003 verkaufte der Senat das SEZ für einen Euro. Der Investor tat wenig, das Gebäude verfiel, Techno-Partys wanderten durch die Räume. Und nun: Abriss. Weg damit. Wohnungen bauen. Natürlich braucht Berlin bezahlbare Wohnungen. Aber die Anwohner*innen fragen auch: Wo bleiben eigentlich die Orte, an denen man atmen und leben kann? Öffentliche Infrastruktur, an der nicht gleich ein Preisschild hängt? Und wieso durften wir nicht mitreden bei den Plänen?
Zahlreiche Architekt*innen und Denkmalexpert*innen weisen auf den Wert des Gebäudeensembles hin. Selbst offizielle Entwürfe schlagen Kompromisse vor, kombinierte Modelle aus Wohnen und Erhalt. Eine Bürger*inneninitiative bittet um Dialog. Doch der Senat tut, was er am besten kann: abwinken. Gesprächsangebote? Ignoriert. Alternativen? Egal. Erinnerungen und Biografien? Ach ja. Genau diese dreiste Gleichgültigkeit macht Menschen wie Susanne Lorenz wütend. Nicht nur, weil ein interessantes Ost-Gebäude verschwindet, sondern auch, weil hier wieder einmal der demokratische Wille den Abbruchbirnen und Kapitalinteressen weichen soll. Die ersten Abrissarbeiten haben bereits stattgefunden.
Serxwebûn
Nach mehr als 45 Jahren und 521 Ausgaben hat mit der Selbstauflösung der PKK dieses Jahr auch die PKK-Parteizeitung Serxwebûn (»Unabhängigkeit«) ihre Arbeit eingestellt. Sie erschien erstmals 1979, ein Jahr nach Gründung der Partei, und war jahrzehntelang deren zentrales Medium. Politische Analysen und parteiideologische Bewertungen zu Themen wie nationaler Befreiung, Jugend, revolutionäres Leben und Frauenorganisierung wurden darin veröffentlicht. Die Serxwebûn nahm ihre Arbeit in einer Zeit auf, in der es kaum Möglichkeiten gab, revolutionäre kurdische Perspektiven zu lesen und sich über die Situation der Kurd*innen zu informieren. Der türkische Staat bekämpfte jegliche politische Organisierung von Minderheiten, Sozialist*innen und Kommunist*innen. Die ersten Ausgaben der Serxwebûn wurden daher verdeckt im Untergrund oder in privaten Wohnungen gedruckt und kostenlos an die Bevölkerung in Nordkurdistan verteilt. Nach dem Militärputsch vom 12. September 1980 in der Türkei musste die Publikation aufgrund verschärfter staatlicher Repression pausieren, ab 1982 wurde sie dann von Europa aus fortgesetzt. Seitdem erschien sie jeden Monat ohne Unterbrechung und war als Bildungs- und Informationsquelle innerhalb der kurdischen Bewegung nicht wegzudenken. Die Zeitung hinterlässt einen riesigen Erfahrungsschatz und hat jahrzehntelang die Sprache des Widerstandes in der Bewegung mitgeprägt. Die letzte Ausgabe dokumentierte den 12. Kongress der PKK, auf dem im Mai die Selbstauflösung und das Ende des bewaffneten Kampfes beschlossen wurden. In der Titelschlagzeile verabschiedet sich die Serxwebûn mit den Worten: »Auf das Menschsein zu beharren bedeutet, auf den Sozialismus zu beharren.«
Madrock Shark 2.0
Die Zehen waren so stark aufgestellt, dass sie gegen die obere Schuhseite drückten, die Hacke hatte keinerlei Bewegungsspielraum, und ohne beide Hände und volle Beinkraft zu mobilisieren, kam man gar nicht erst rein in den Madrock Shark 2.0. Die Schuhe sind beim Bouldern wahrscheinlich so etwas wie der Tennisschläger beim Tennis: Ohne ein gutes Modell geht nichts. Und der Madrock Shark 2.0 war einfach perfekt. Nicht nur konnte man damit auf zwei Millimeter breiten Tritten stehen, man konnte es – trotz Beulen auf den großen Zehen – wundersamerweise auch zwei Stunden ohne Ausziehen darin aushalten. Das ist bei einem Schuh, in dem man barfuß Sport treibt, eine wichtige Schutzfunktion für die Umwelt. Apropos Umwelt: Für gutes »Grip-Verhalten« werden Kletterschuhe teilweise mit Gummi überzogen. Der Preis dafür ist, dass die Feinstaubbelastung in den Hallen durch den Abrieb bis zu tausendfach höher ist als an Autobahnen. Aber die Leidensfähigkeit gehört zum Boulder-Lifestyle, wie die unzähligen anderen peinlichen Klischees, die leider alle wahr sind. Die »Boulderszene« ist ein Hort von unangenehmsten Männlichkeitskonstruktionen, Körpernormierung und Wettbewerb. Wer ohne Schürfwunden nach Hause geht, hat nicht gebouldert. Und es gibt wirklich Leute, die wickeln sich die Füße mit Klarsichtfolie ein, um in den extra engen Schuh zu kommen.
Und deshalb: Ja, es gibt härtere Verluste zu beklagen im Jahr 2025, als den Madrock Shark 2.0. Aber mit dem richtigen Kletterschuhmodell und den richtigen Kletterpartner*innen, ist Bouldern trotz allem der weltbeste Sport.
Kölner Hauptbahnhof
»Kannste nix machen«, müssen im November hunderttausende Bahnfahrer*innen im Raum Köln in sich hinein geflüstert haben. Für zehn Tage fielen alle Fern- und Regionalverbindungen zum und vom Kölner Hauptbahnhof aus. Mit täglich mehr als 1.300 Verbindungen gehört der Bahnhof zu den wichtigsten Drehkreuzen des Landes und spielt auch für Reisen nach Frankreich und Belgien eine bedeutende Rolle. Eigentlich sollte nur ein modernes Stellwerk installiert werden. Doch aufgrund eines Softwarefehlers wurde die Inbetriebnahme verzögert. Am härtesten traf es die Pendler*innen, für die sich der Weg zur Arbeit teilweise verdoppelte.
Im Frühjahr 2026 soll der Kölner Bahnhof erneut gesperrt werden. Das Blöde ist, dass gleichzeitig auch die Strecke Köln-Wuppertal-Hagen im Zuge der großen »Generalsanierung« der Bahn eingestellt ist. Das bundesweite Reparieren soll bis 2036 (Achtung: Richtwert) anhalten und betrifft die viel genutzten »Hochleistungsstrecken«.
Es ist absurd, aber ob es nun Ausfälle wegen der maroden Infrastruktur sind oder aufgrund der Sanierung, aus Fahrgastsicht ist das letztlich egal. Denn was, wenn die Modernisierung so langsam verläuft, dass sie immer wieder von vorne anfängt, weil die Infrastruktur am Ende der Maßnahme schon wieder veraltet ist? Davor zumindest warnt das Bündnis Bahn für Alle, das die Konzernaktivitäten seit vielen Jahren kritisch begleitet.
Schon jetzt heißt es seitens der Bahn, dass das Budget der Bundesregierung für eine wirkliche Modernisierung nicht ausreiche. Diese sieht aber keinen Grund, das ganze neoliberale Konzept einer hochprofitablen Bahn über Bord zu werfen. Naja, und sie ist außerdem damit beschäftigt, den Verbrenner und die mindestens genauso dysfunktionale Autoindustrie zu »retten«. Autonation und so, kannste nix machen.

Skype
2025 hat dann auch Skype Tschüss gesagt, wahrscheinlich in besserer Bild- und Tonqualität als Mitte der 2000er Jahre. 2003 wurde das Programm für Bildtelefonie auf den Markt gebracht. Dort konnte man mit Freund*innen über das Internet ein Videotelefonat führen. Waren Zeit und Geld da, um im Studium ein Auslandssemester einzulegen (was auf den Autor dieser Zeilen nicht zutraf), nutzten es viele, um regelmäßig aus ihrem halbjährlichen Aufenthalt in London oder Lissabon zu berichten. Auf der anderen Seite der Leitung saß man und produzierte mithilfe einer geliehenen Webcam mit fettiger Linse und dem schlechten Internet dieser Zeit Bilder, die an Tetris erinnerten – wenn nicht schon vorher die Audioverbindung zusammenbrach. Tag ein, Tag aus schaute man dann, an PCs oder klobigen Laptops sitzend, in die Tetris-Gesichter, die von koreanischer Karaoke und slowakischem Schnaps erzählten.
Skype wurde 2011 von dem Computer-Riesen Microsoft gekauft, was dem Programm dieses Jahr zum Verhängnis wurde. Der Rufton, der wie der abgesetzte Hilferuf einer U-Boot-Besatzung klang, verstummte endgültig, weil Skype in seiner potenziell scheinbar größten Stunde, Corona, nicht glänzte. Mit Zoom, aber auch dem Microsoft-eigenen Teams taten sich die Firmen nicht so schwer wie mit Skype, denn diese Anwendungen passten mit ihren kooperativen Kalendern und Aufzeichnungsfunktionen besser zum Kontrollbedürfnis der Chefs und der heimischen Bürosimulation während der Pandemie. Gute Fahrt, liebes U-Boot, tschüss Tetris-Gesicht!
Gedruckte taz und konkret
Die eine Publikation wurde von der anderen als »Kinder-FAZ« verspottet. Ob es seitens der taz, die der 2019 verstorbene langjährige konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza einst so betitelt hatte, eine Entsprechung für das Hamburger Magazin gab, entzieht sich meiner Kenntnis. Das liegt daran, dass ich konkret um die Jahrtausendwende intensiv las, die taz eigentlich nie. Das wiederum lag auch an Gremlizas Verdikt. Und an vielen Artikeln in konkret, die die kriegsbefürwortende Rolle der taz während der Jugoslawienkriege kritisierten.
Die zumindest einseitig in Abneigung verbundenen Blätter haben in diesem Jahr ihr gedrucktes Erscheinen eingestellt. Die letzte konkret-Ausgabe erschien im Dezember und war ein Notmanöver, um das Überleben und Erscheinen als E-Paper zu sichern. Bei der taz war es anders: Lange vorbereitet und angekündigt, wurden die gedruckten Ausgaben unter der Woche ab Oktober 2025 eingestellt (digital erscheint die Zeitung weiterhin als E-Paper), während die aufgeplusterte Wochentaz weiter gedruckt wird. Damit trägt die taz den neuen Lesegewohnheiten Rechnung und passt sich den geänderten ökonomischen Rahmenbedingungen an: deutlich steigende Kosten für Vertrieb und Druck bei schwindender Auflage. Bei der taz scheint die Strategie aufzugehen, bei konkret eher nicht. Die Telefone in der Redaktion standen nicht mehr still, es gab einige E-Mails, hört man. Viele Leser*innen bedauern das Aus für Print. Doch siehe da! Im Editorial der Dezember-Ausgabe wird eine Rückkehr zum gedruckten Heft in Aussicht gestellt. Wenn 1.000 Abonnent*innen bereit sind, konkret für 15 Euro zu beziehen, wird wieder gedruckt. Ein stolzer Preis, zuletzt kostete eine Einzelausgabe 7 Euro.
SchwuZ
Wie die monatliche schwule Dorfdisko in Klein- und Mittelstädten Deutschlands war das SchwuZ: Gloria Gaynor, Lady Gaga, Madonna, Queen und zumindest für meinen Geschmack viel zu oft auch Helene Fischer klangen eigentlich jede Nacht durch die Wolken floralen Parfums und Trauben knutschender Mittzwanziger neben zahlreichen Tunten und Drag Queens auf 1.500 Quadratmetern. Ein Ausnahmeort queerer Clubkultur in der technoaffinen Hauptstadt.
Das SchwuZ war ein Kind der westdeutschen Schwulenbewegung, aus der es 1977 hervorging. Ihrer Gallionsfigur, der Polittunte, war das SchwuZ auch nach einigen Umzügen noch Denkmal und Zuhause. So erinnerte eine riesige Fotografie vor dem viel zu kleinen Darkroom an die Soul-Tunte Melitta Sundström, in den 1980er Jahren Teil der LadiesNeid – einer Tuntenshow, die später in Formaten wie der Schangelig ihre Neuauflage fand. Melitta, wie auch der sie fotografierende Jürgen Baldiga, dessen nacktes Selbstporträt im selben Gang hing, verstarben viel zu früh an den Folgen ihrer HIV-Infektionen. Geschichte, die sich in unsere Räume und Körper eingeschrieben hat.
Wie die Bewegung selbst musste sich das SchwuZ immer wieder neu erfinden, und aus einem schwulen Zentrum wurde ein queerer Club. Kritik an Rassismus und anderen Ausschlüssen zwangen immer wieder zur Transformation. Es war schließlich zuallererst ein Communityort, um den gerungen werden musste. Am Ende fiel das SchwuZ dem neoliberalen Stadtumbau zum Opfer. Immer weniger der überdurchschnittlich oft prekär lebenden queeren Stadtbewohner*innen können sich das Ausgehen leisten – auch wenn das SchwuZ bis zuletzt versuchte, sich dem Wettbewerbsdruck zu entziehen. In der letzten Nacht tanzten wir unter Tränen, Arm in Arm, bis der letzte Ton verklang zu Madonna und ja, auch zu Helene Fischer. Adieu, du alte Tunte SchwuZ!


