Andere Wege finden, Schutz aufzubauen
Im Kampf gegen die Militarisierung braucht es Solidarität von allen, sagen Natalia García Cortés und David Scheuing vom Netzwerk War Resisters International
Interview: Paul Dziedzic
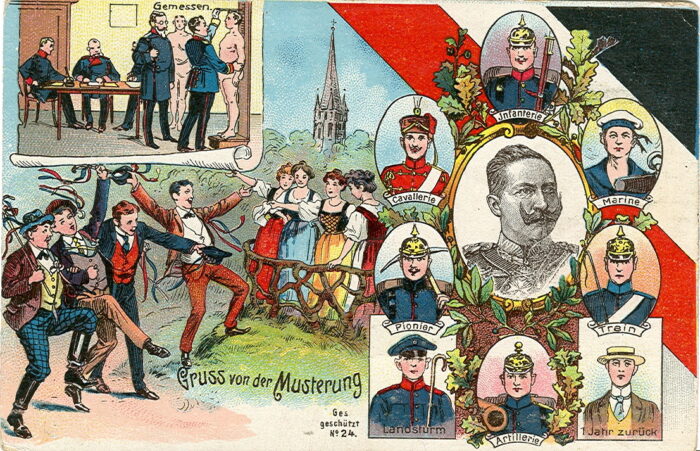
Weltweit hat die Zahl an Konflikten zugenommen, in Europa schreitet die (Wieder-)Einführung des Wehrdienstes voran. David Scheuing und Natalia García Cortés von War Resisters International, einem globalen Netzwerk antimilitaristischer Gruppen, erklären, wie die internationalistische Friedensbewegung auf diese Entwicklungen blickt.
Im vergangenen Dezember organisierten Schüler*innen in Deutschland landesweite Proteste gegen das neue Wehrdienstgesetz. Habt ihr die Entwicklungen verfolgt, und was denkt ihr darüber?
David Scheuing: Es war ein besonders schöner Moment zu sehen, wie sich die Schüler*innen unabhängig von der älteren deutschen Friedensbewegung organisieren. Ähnlich wie bei Fridays for Future haben die Schüler*innen erkannt, dass sie nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen worden waren und diese Beschlüsse sie massiv betreffen würden.
Natalia García Cortés: Es ist seltsam, die Militarisierung in Europa zu beobachten, weil sie normalerweise anderswo stattfindet. Aber jetzt sehen wir Diskussionen in Kroatien, Serbien, sogar in Frankreich und Spanien. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber letztendlich hat es damit zu tun, dass das Militär zur Standardantwort geworden ist und Krieg als unvermeidlich gesehen wird. Das ist eine sehr eng gefasste Vorstellung von Sicherheit, die nur in Bezug auf das Militär definiert wird. Soziale Fürsorge oder Diplomatie kommen erst an zweiter Stelle. Ich finde es wirklich gut, dass die Schüler*innen auf die Straße gehen und für sich selbst sprechen. Aber ich denke, dass auch die Geschichte der pazifistischen Bewegungen nützlich sein kann für die Frage, wie man auf diesen Trend reagieren soll, insbesondere in Ländern mit einer langen Tradition und starken Bewegungen. Neben Deutschland zum Beispiel in Spanien, wo sich die Insumiso-Bewegung mit gewaltfreien direkten Aktionen gegen die Wehrpflicht wehrte.
Natalia García Cortés
lebt in Bogotá, Kolumbien. Sie ist Teil des »Right to Refuse to Kill« Programms der War Resisters International, das sich auf die Verweigerung des Militärdienstes aus Gewissensgründen konzentriert. Das Programm beobachtet Änderungen der Wehrpflichtgesetze weltweit und verschickt Warnmeldungen, wenn Kriegsdienstverweigerer*innen aus Gewissensgründen inhaftiert sind oder Gefahr laufen, inhaftiert zu werden.
David Scheuing
ist Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner*innen (DFG-VK), einer Sektion der WRI. Er ist auch Teil des Exekutivkomitees des WRI, das deren politische Arbeit leitet. WRI ist ein globales pazifistisches und antimilitaristisches Netzwerk mit Mitgliedsgruppen in über 90 Ländern. Es wurde 1921 in den Niederlanden gegründet.
Also werden alte Formen des Wissens wieder relevant.
David: Ich denke schon. Früher gab es viel implizites Wissen: Man erhielt Informationen von einem Freund, der das schon durchgemacht hatte. Auch wenn die jüngere Generation das nicht mehr hat, ist dieses Wissen nicht vollständig verloren gegangen. Wir erleben ein Comeback lokaler Beratungsnetzwerke, weil es ein Gefühl der Dringlichkeit gibt. Das gilt auch außerhalb Deutschlands. Derzeit läuft ein Prüfverfahren der Vereinten Nationen zum Status der Kriegsdienstverweigerung, zu dem auch viele Mitgliedsorganisationen der WRI Stellung genommen haben. Im Juni werden wir wissen, wie ernst die Lage für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung weltweit ist.
Was droht Kriegsdienstverweiger*innen in dieser Welle der Einführung und Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Natalia: Es gibt viele Länder, in denen Kriegsdienstverweigerer*innen mit negativen Konsequenzen rechnen müssen. Da sind natürlich Russland und die Ukraine, aber auch Länder wie Südkorea, wo Kriegsdienstverweigerer traditionellerweise eingesperrt werden. Selbst in einigen Teilen Lateinamerikas, wo man gesetzlich geschützt ist, ist es schwierig zu verweigern, weil den Menschen die Mittel oder das Wissen fehlen, um ihre Erklärungen zu begründen. Hinzu kommt das Problem, dass in vielen Ländern die Ausschüsse, die über die Verweigerung entscheiden, voreingenommen sind. In Griechenland beispielsweise bestehen die Kommissionen aus Militärs. Dann gibt es den Fall der Türkei, die das Recht auf Verweigerung nicht anerkennt. Wer trotzdem verweigert, riskiert den sogenannten zivilen Tod und gerät in einen endlosen Kreislauf der Unterdrückung, vom Arbeitsmarkt bis hin zu täglichen Begegnungen mit Behörden. Und schließlich gibt es Länder wie Eritrea, wo es kein Recht auf Verweigerung gibt und jede*r für sehr lange Zeit zum Militärdienst eingezogen wird.
David: Für Europäer*innen könnte es schlimmer sein. In den meisten Ländern gibt es Schutzmaßnahmen für das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen, die auf die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zurückgehen. Wir sollten jedoch vorsichtig sein, weil staatliche Akteure kontinuierlich versuchen, Menschen daran zu hindern, ihr Recht auszuüben. Wir beobachten die Situation daher genau.
Wir sehen auch einen Anstieg zwischenstaatlicher Kriege wie zwischen Russland und der Ukraine und bewaffneter Auseinandersetzungen wie zwischen Kambodscha und Thailand. Hat das einen Einfluss auf die Einberufungen?
Natalia: Was wir in Russland und der Ukraine beobachten, ist, dass Kriegsdienstverweigerer nicht anerkannt, ständig verfolgt und bedroht werden, das trifft auch die Familien. Immer mehr Menschen wollen deshalb fliehen und versuchen, einen Ort zu finden, an dem sie Asyl beantragen und als Geflüchtete anerkannt werden. Wir kennen zum Beispiel Fälle in Deutschland. Darüber hinaus werden Organisationen, die sich für Kriegsdienstverweigerung einsetzen, als »ausländische Agenten« bezeichnet. Das ist ein Hindernis für diese Organisationen. Das ist auch in der Ukraine und in Russland der Fall.
David: Obwohl sie mit Hindernissen konfrontiert sind, versuchen unsere Mitgliedsorganisationen in Russland und der Ukraine trotzdem, innerhalb des Systems zu arbeiten und die Wehrdienstverweigerer mit juristischen Mitteln zu verteidigen. In Deutschland versuchen wir, die Rechte derjenigen zu verteidigen, die desertiert sind, aber Gefahr laufen, in den Krieg zurückgeschickt zu werden, obwohl ihnen hier Sicherheit versprochen wurde. Mit Blick auf Russland müssen wir aber auch die Bedeutung feministischer Antikriegs-Untergrundnetzwerke hervorheben, die Wege finden, Menschen zu verstecken und ihnen zur Flucht zu verhelfen. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es in jedem Kriegskontext immer Menschen gibt, die sich gegen das System auflehnen.
Natalia: In anderen Fällen kann Sichtbarkeit dazu beitragen, dass Menschen in Sicherheit bleiben. Wir haben den Fall des ersten öffentlichen Wehrdienstverweigerers in Thailand unterstützt. Diese internationale Sichtbarkeit hat ihm geholfen und anderen gezeigt, dass Verweigerung eine Option ist.
An sich ist es nicht schwer, eine antimilitaristische Idee in Bewegungen zu integrieren, aber manchmal sind andere Themen dringlicher.
Natalia García Cortés
Habt ihr in diesen zunehmend turbulenten Jahren eine Veränderung in eurer Arbeit festgestellt?
David: Da die Kriegsmaschinerie nie zum Stillstand gekommen ist, hat sich unsere Arbeit in den letzten zehn Jahren im Großen und Ganzen nicht dramatisch verändert, sondern eher intensiviert. Natürlich sehen wir in den Ländern, in denen die Wehrpflicht wieder eingeführt wurde, einen Anstieg der Unterstützungsanfragen von Kriegsdienstverweigerern und eine verstärkte Repression seitens der Staaten. Aber es gibt auch viele repressive Staaten, die sich nicht wesentlich verändert haben – was oft vergessen wird. WRI verfolgt eine langfristige Perspektive, um die Bedingungen zu beseitigen, unter denen Krieg entstehen kann, und diese Bedingungen haben sich verschlechtert: massive Militärausgaben, Militarisierung der Polizei, Auswirkungen des Klimawandels, um nur einige zu nennen.
Natalia: An sich ist es nicht schwer, eine antimilitaristische Idee in Bewegungen zu integrieren, aber manchmal sind andere Themen dringlicher. Wir sehen auch, dass es schwierig ist, Spenden für unsere Arbeit zu sammeln, weil es einfacher erscheint, sich mit den Folgen abzufinden, als sich mit den Ursachen zu befassen. In Lateinamerika beispielsweise müssen die Menschen wieder für ihre Grundrechte kämpfen. Deshalb versuchen wir, unsere pazifistische Arbeit mit anderen Bewegungen wie Klima oder Feminismus zu verknüpfen, unsere Ziele mit breiteren sozialen Anliegen zu verbinden und Wege zur Zusammenarbeit zu finden.
Wir beobachten eine zunehmende Aushöhlung des Völkerrechts, auf das sich viele NGOs und Bewegungen stützen. Wie geht ihr strategisch damit um?
David: In dieser Frage stehen wir noch am Anfang. Wir sehen unsere gegenseitigen Kämpfe gegen diesen Militärapparat und erkennen, dass dieser uns zwingt, eine Realität zu akzeptieren, in der unsere Ablehnung nicht zählt. Deshalb müssen wir innerhalb unserer Bewegungen andere Wege finden, Schutz aufzubauen. Dann müssen wir Wege finden, wie wir uns auf die Straße stellen und öffentlich unsere Ablehnung zum Ausdruck bringen können. Das muss nicht nur diejenigen einschließen, die von der Wehrpflicht betroffen sind, sondern uns alle. Die feministischen Organisationen in unserem Netzwerk haben immer betont, wie wichtig eine kollektive Verweigerung ist – eine, die deutlich macht, dass wir nicht Teil des Kriegssystems sein wollen.
Natalia: Was auch Wirkung zeigt, ist internationale Solidarität. Wir informieren uns gegenseitig über die aktuellen Ereignisse und schaffen Sichtbarkeit, die manchmal helfen kann, beispielsweise durch Briefkampagnen und Druck auf die Behörden. Neben Demonstrationen, an denen möglichst viele Menschen teilnehmen, kann internationale Sichtbarkeit auch dann Wirkung zeigen, wenn internationale Rechtsmechanismen versagen. Außerdem müssen wir dagegen ankämpfen, dass die Militarisierung weiter normalisiert wird. Wir müssen weiterhin aufzeigen, welche Länder Konflikte unterstützen, in Konflikte investieren und diese mit Waffen beliefern.
Apropos Sichtbarkeit: Wir werden wahrscheinlich noch mehr Proteste der Schüler*innen in Deutschland sehen. Habt ihr Kontakt zu ihnen aufgenommen? Werden ihr euch daran beteiligen?
David: Obwohl wir in Kontakt stehen, finde ich es enorm wichtig, dass die Bewegung selbst aus Schüler*innen besteht, sich selbst organisiert und eigene Strategien entwickelt. Wir können ihnen lediglich materielle und ideologische Unterstützung bieten. Im Sinne praktischer Solidarität werde ich im März aber auch auf die Straße gehen.
