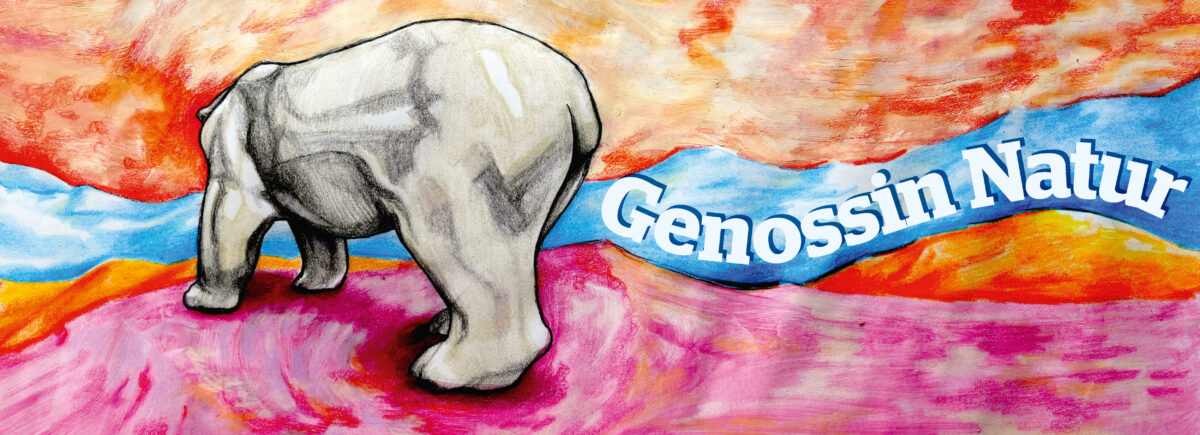Das Machen von Natur
Einst galt Biotechnologie als Bedrohung für die Biodiversität – heutzutage wird sie als Instrument technischer Beherrschung genutzt
Von Eva Gelinsky

In der internationalen Naturschutzszene deutet sich ein Paradigmenwechsel an. Anfang des 20. Jahrhunderts verstand sich der (»westliche«) Naturschutz primär als kulturelle Aufgabe, nicht als Teil dessen, was wir heute angewandte Ökologie nennen. Bestimmte – gemessen an der Gesamtzahl wenige – Arten waren etwas wert, entweder aus ästhetischen Gründen und/oder weil sie als Teil der symbolischen Welt wichtig waren. Ökologische Begründungen für Artenschutz begannen sich ab den 1950er Jahren durchzusetzen. Während früher das Vorkommen wichtiger »Leitarten« oder ästhetisch schöne, »harmonische« Landschaftsbilder noch klarer als Ausdruck einer gelungenen Mensch-Natur-Beziehung interpretiert worden waren, wurden sie nun (vermeintlich naturwissenschaftlich) als »ökologisch intakt« klassifiziert.
Der Naturschutz blieb damit seiner konservativen Grundhaltung treu, da es weiterhin darum ging, »organisch gewachsene« Landschaften vor einem auf Naturbeherrschung und -ausbeutung ausgerichteten Kapitalismus zu schützen. Mit dem Vordringen ökonomischer Naturschutzbegründungen begann sich der kapitalistische Machbarkeitsanspruch jedoch auch im Naturschutz selbst auszubreiten. Plötzlich standen Fragen im Raum wie: Sollten ausgestorbene Arten biotechnologisch »wiederhergestellt«, invasive Spezies dagegen mit Hilfe biotechnologischer Methoden ausgerottet werden? Sind Organismen unter Einsatz synthetischer Biologie und Künstlicher Intelligenz (KI) technisch optimierbar? Und grundlegender: Was für eine Art von »Natur« soll in Zukunft noch geschützt werden, wenn es zunehmend auch um das »Designen« von Wildarten, also das »Machen« von Natur geht?
Zunehmend dominiert der »neoliberale« Naturschutz die internationalen Foren.
Die Auseinandersetzungen um den Umgang mit Biotechnologien haben auch die internationalen Naturschutzforen erreicht. Aktuelle Kontroversen in der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) und in den Verhandlungen über das Übereinkommen über die biologische Vielfalt zeigen, dass Vertreter*innen eines vorsorgenden Natur- und Umweltschutzes, der biotechnologischen Anwendungen durch Regulierungsauflagen Grenzen setzt, immer mehr in die Defensive geraten. Wissenschaftler*innen, die sich darum bemühen, einen Überblick über die rasanten Entwicklungen neuer Biotechnologien zu behalten und deren Risiken abzuschätzen, werden systematisch ausgebremst. Zunehmend dominiert werden die internationalen Foren von Vertreter*innen eines »neoliberalen« Naturschutzes. Dieser propagiert nicht nur allerlei marktbasierte Bepreisungsinstrumente wie biodiversity credits (ak 689), sondern setzt sich auch offensiv für die Nutzung verschiedenster Biotechnologien ein. Da auch hier der neoliberale Glaubenssatz gilt, dass staatliche Aufsicht zurückgefahren, »Markt« und privaten Unternehmen dagegen »Freiheit« zu gewähren sei, steigt der Druck, die Technologien möglichst schnell und weitgehend unreguliert in die Anwendung zu bringen.
Um eine Erhaltung von »Natur« und Biodiversität geht es in dieser Agenda kaum, vielmehr sollen weitere Bereiche von »Natur« verwertbar gemacht werden. Dabei leisten biotechnologische Methoden gute Dienste, wenn es um die Durchsetzung von Eigentumsmonopolen (Privatisierung) geht, die eine Voraussetzung für die Inwertsetzung von Natur und die Verwertung des investierten Kapitals sind: Instrumente der Bioinformatik und der Sequenzierung erlauben einen immer detaillierteren Einblick in die Genome von Organismen (Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen), ihr biotechnologisches »Design« macht schließlich deren Patentierung möglich. Der eigentliche Treiber dieser Entwicklungen ist also einmal mehr ein ökonomischer.
Vorsorgeprinzip wird ignoriert
Als das UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt, kurz Biodiversitätskonvention, vor über 30 Jahren verabschiedet wurde, wurde die Biotechnologie noch als Bedrohung für die Biodiversität und deren »nachhaltige« Nutzung angesehen. Um die Artenvielfalt zu erhalten, sollten alle unterzeichnenden Länder die »Risiken, die mit der Nutzung und Freisetzung der durch Biotechnologie hervorgebrachten lebenden modifizierten Organismen zusammenhängen« regeln und kontrollieren (Artikel 8g). Heute hat sich die Situation grundlegend verändert. Im Kontext der Biodiversitätskonvention wird nun prominent über den möglichen Nutzen der Biotechnologien gesprochen; das im Übereinkommen verankerte Vorsorgeprinzip wird dabei immer öfter schlicht ignoriert.
Dabei stehen heute weit wirkungsmächtigere Biotechnologien zur Verfügung als vor 30 Jahren. Die Biodiversitätskonvention fasst sie unter dem Begriff der synthetischen Biologie zusammen. Viele der Anwendungen (z.B. die Sequenzierung) sind zudem deutlich billiger geworden und daher auch kleineren Unternehmen zugänglich. Wurden früher Organismen lediglich »gentechnisch verändert«, so können heute mittels DNA-Synthese, Bioinformatik, Genom-Editierung und KI völlig neuartige Organismen geschaffen werden. Neu ist auch, dass biotechnologisch »bearbeitete« Organismen nicht mehr nur in geschlossenen Systemen und in der Landwirtschaft, sondern auch in der »freien« Natur eingesetzt werden sollen.
Ein Beispiel ist die umstrittene Gene-Drive-Technologie. Mithilfe eines Gene Drives wird die Vererbung einer bestimmten genetischen Veränderung beschleunigt, die Mendelschen Regeln werden dabei umgangen. Diese besagen, dass in jeder Generation durchschnittlich 50 Prozent der Nachkommen eine bestimmte Genvariante erben. Mit Gene Drive sind es im Idealfall 100 Prozent, so dass nach wenigen Generationen alle Individuen einer Population die gewünschte Veränderung in ihrem Erbgut aufweisen (z.B. Unfruchtbarkeit). Gene Drives sollen beispielsweise dazu benutzt werden, bestimmte Eigenschaften von Wildpopulationen zu verändern oder invasive Arten auszurotten.
Eine 2022 auf der 15. UN-Biodiversitätskonferenz (COP 15) eingesetzte multidisziplinäre Expert*innengruppe bekam die Aufgabe, die jüngsten technologischen Entwicklungen im Bereich der synthetischen Biologie regelmäßig zu beobachten und zu bewerten. Sie warnte davor, dass die »weitreichende und dauerhafte gentechnische Veränderung wildlebender, vererbungsfähiger Organismen« auf eine »Neugestaltung der Natur« hinauslaufen könnte.
Auf der letzten Biodiversitätskonferenz, der COP 16 Ende 2024 in Cali (Kolumbien), wurde die Weiterarbeit der kritischen Expert*innen allerdings deutlich beschnitten. Vertreter*innen verschiedener Staaten konnten durchsetzen, dass weniger die Risiken, sondern verstärkt der »derzeitige und potenzielle Nutzen der synthetischen Biologie« mit Blick auf die Umsetzung des Kunming-Montreal-Abkommens, mit dem der Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 gestoppt werden soll, Fokus der Forschung sein soll. Die nächste UN-Artenschutzkonferenz, die COP 17 2026 in Armenien, soll zudem einen Aktionsplan beschließen, der es vor allem finanziell schwächeren Ländern ermöglicht, ihren »Bedarf an Kapazitätsaufbau, Technologietransfer und Wissensaustausch zu decken«.
Labor Globaler Süden
In Afrika werden bereits seit einigen Jahren Vorbereitungen getroffen, um die als besonders riskant und unausgereift geltende Gene-Drive-Technologie im Freiland zu testen. Das Projekt zielt auf die Ausrottung einer Mückenart, die Malaria überträgt. Das vor allem von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung (BMGF) finanzierte Projekt Target Malaria ist in mehreren Ländern des afrikanischen Kontinents tätig, darunter Burkina Faso, Ghana, Uganda, Mali und seit Kurzem auch Kap Verde.
Die EU-Kommission möchte gentechnisch veränderten Mais, Weizen und Wildpflanzen ohne Auflagen erlauben, Risiken und Umweltwirkungen werden ignoriert.
Nichtregierungsorganisationen wie das Afrikanische Zentrum für Biodiversität (ACB) kritisieren das Projekt scharf: Nicht nur seien die derzeitigen Methoden zur Risikobewertung für die Anwendung von Gene Drives völlig unzureichend. Es mangele auch an Daten, die für die Vorhersage der potenziellen Wirksamkeit der Gene-Drive-Technologie erforderlich sind. Auch die Behauptungen der Entwickler*innen, dass Risiken unwahrscheinlich seien, blieben unbelegt, da bei den geplanten Projekten nicht bekannt ist, wie andere Organismen, z.B. Pflanzen, Fische, Fledermäuse und Insekten, auf die Freisetzung von Gene-Drive-Mücken reagieren könnten. Da darüber hinaus mehrere Anopheles-Mückenarten Malaria übertragen, könnte die Bekämpfung nur einer Mückenart dazu führen, dass eine andere Art an ihre Stelle tritt und weiterhin Malaria überträgt.
Freilandexperimente in Europa
Eine breite Anwendung von Biotechnologie im Freiland ist auch in Europa geplant. Die EU-Kommission schlägt eine weitreichende Deregulierung neuer gentechnischer Verfahren vor. In Zukunft sollen nicht nur Mais und Weizen, sondern auch gentechnisch veränderte Wildpflanzen ohne Auflagen freigesetzt werden können.
Auch hier fehlen Daten zur Risikoabschätzung, Umweltwirkungen werden ignoriert. Ausgeblendet wird vor allem, dass die veränderten Pflanzen auf eine ohnehin durch Umweltgifte und die Erderhitzung gestresste Natur treffen. Beispiel Bienengesundheit: Agrarunternehmen nutzen die neuen Verfahren, um pflanzliche Inhaltsstoffe ihren Bedürfnissen anzupassen. Bei Raps und Leindotter, wichtige Bestäuberpflanzen, soll durch einen Eingriff in den Pflanzenstoffwechsel der Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren drastisch gesenkt werden. Denn diese sind anfällig für Oxidation – und daher schlecht geeignet für die industrielle Verarbeitung der Samen zu Agrosprit oder Speiseöl. Da sich aufgrund des Eingriffs auch der Gehalt an Fettsäuren im Pollen verändert, sind auch Bienen betroffen: Nehmen Bienen zu wenig dieser Fettsäuren auf, werden ihre Gehirnfunktionen und ihre Fortpflanzungsfähigkeit gestört.
Im Wettlauf um Verwertungsmöglichkeiten dringt der Kapitalismus also immer tiefer in die Natur ein. Angesichts von Biodiversitätskrise und Erderhitzung wäre nicht nur der Naturschutz aufgerufen, dieser Kolonisierung und Zurichtung endlich wirksame Grenzen zu setzen.
Illustrationen: Donata Kindesperk
Die Illustrationen dieses Themas sowie auf dem Titel von ak 718 Titel sind von Donata Kindesperk. Donata ist Buntstift-Ultra und macht Illustrationen zum Weltgeschehen. Ihr findet sie auf Instagram unter @finsterperk.