Marxist ohne Garantie
Fanon analysierte vieles, was auch im Abolitionismus wieder aufgegriffen wurde, sagt die Soziologin Vanessa E. Thompson
Interview: Vincent Bababoutilabo
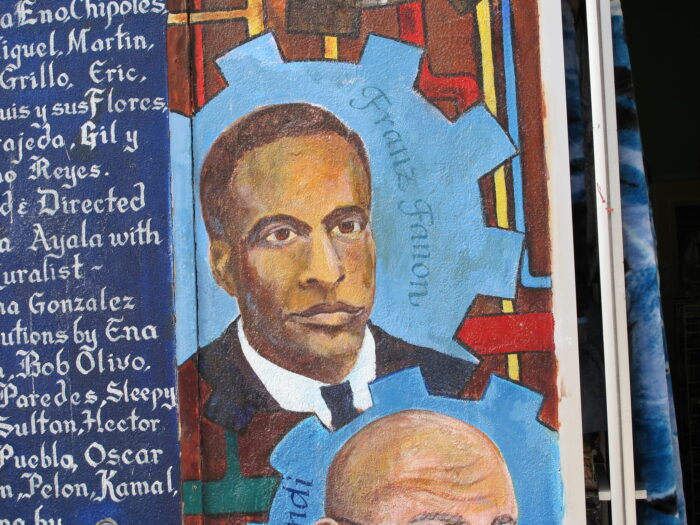
Frantz Fanon, geboren 1925 auf Martinique, wurde zu einem der wichtigsten Denker und Akteur der antikolonialen Befreiung. Zum 100. Geburtstag Fanons sprachen wir mit der Abolitionistin Vanessa E. Thompson über die Aktualität seiner Werke.
Du hast bereits 2009 in deiner Magisterarbeit eine Kritik an der postkolonialen Rezeption Fanons formuliert. Oft beziehen sich diese Lesarten vor allem auf Fanon als Psychoanalytiker – sein revolutionäres Engagement wird dabei ausgeblendet. Warum brauchen wir aber beides – den Psychoanalytiker und den Revolutionär Fanon?
Vanessa E. Thompson: Es gibt enorme Unterschiede innerhalb der postkolonialen Theorie. Man verfällt da schnell in pauschale Urteile. Aber wenn man es einmal generalisierend sagen will: In der postkolonialen Rezeption wird oft stärker auf Fanons Frühwerk Bezug genommen, weil dort Psychoanalyse, Fragen der Subjektivierung und Phänomenologie sichtbarer im Vordergrund stehen.
In meiner Arbeit habe ich versucht, das Früh- nicht gegen das Spätwerk auszuspielen. Besonders zentral war und ist für mich dabei der Begriff der kolonialen Entfremdung. In beiden Werkphasen geht es Fanon um die Überwindung kolonialer Entfremdung – als ein Phänomen, das sowohl eine sozialpsychologische als auch eine, er nennt es, in erster Linie politökonomische Dimension hat.
Wir brauchen beide Perspektiven, um Fanons Werk als Ganzes lesen zu können – sie sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Analyse. Er war eben kein konventioneller Marxist, schon gar kein orthodoxer, sondern auch stark beeinflusst von phänomenologischen Ansätzen und auch vom Existenzialismus Sartres. Man könnte mit Stuart Hall sagen: A Marxist without guarantees.
Für Fanon sind Subjektivität und Objektivität untrennbar miteinander verbunden. Es geht auch um zwischenmenschliche Beziehungen, ohne sie zu reduzieren, wie es liberale Ansätze tun.
Fanon bediente sich zwar marxistischer Analyse und Begrifflichkeiten, ging jedoch nie in einem ökonomischen Determinismus auf. Befreiung bedeutete für ihn nicht allein die radikale Transformation objektiver Verhältnisse. Die Überwindung des kolonialen Kapitalismus ist nicht erreicht, wenn sich die Veränderung nur auf Staat, Produktionsweise und Eigentumsverhältnisse beschränkt, aber die Beziehungen zwischen Menschen unverändert bleiben. Für ihn sind Subjektivität und Objektivität untrennbar miteinander verbunden. Es geht ihm auch um zwischenmenschliche Beziehungen, ohne sie auf eine naive Weise zu reduzieren, wie es oft liberale Ansätze tun.
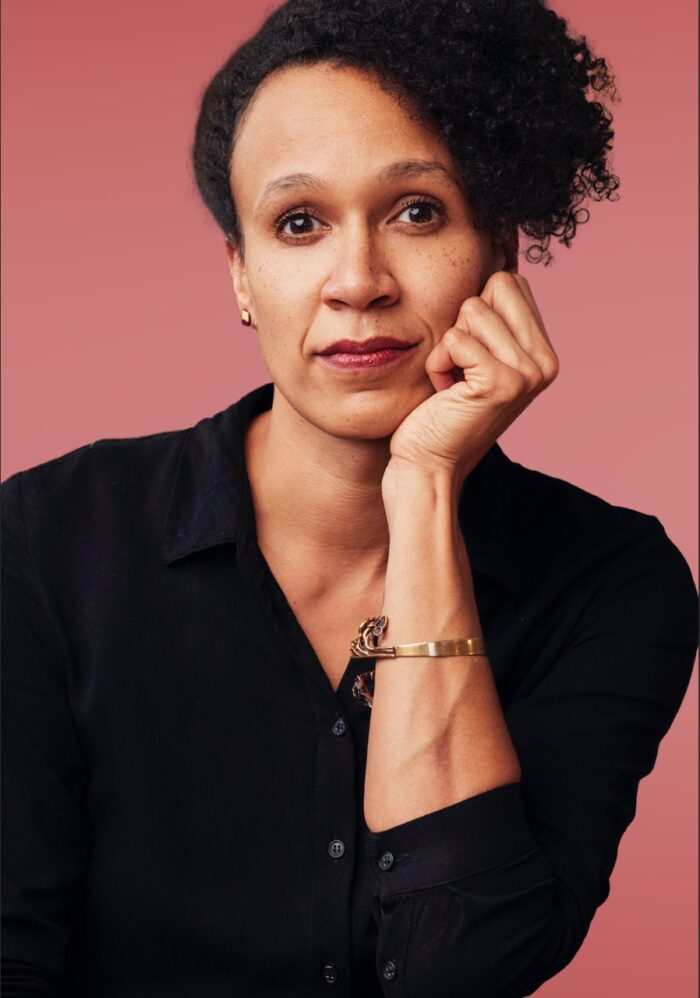
Vanessa E. Thompson
forscht und lehrt im Bereich der Black Studies und antikolonialen Theorien, mit besonderem Fokus auf Abolitionismus, an der Queen’s University, Kanada. Sie ist in transnationalen abolitionistischen Bewegungen aktiv.
Fanon hat einen bemerkenswert festen Platz an der neoliberalen Universität gefunden. Hier sind aktuell Denkrichtungen wie der Afropessimismus nach Frank Wilderson III populär. (ak 678) Ihre Vertreter*innen verstehen Anti-Blackness als ontologischen Zustand – Schwarze Menschen seien gefangen in einer fortbestehenden Sklavenposition ohne Aussicht auf Befreiung. Was unterscheidet Fanon von Denker*innen wie Wilderson?
In Schwarze Haut, weiße Masken gibt es eine besonders interessante Stelle, in der Fanon von einer Polizeikontrolle erzählt, in der er für einen Araber gehalten wurde. Als er sagt, dass er von Martinique kommt, entschuldigen sich die Polizisten hastig. Araber, so die Polizisten, seien etwas ganz anderes als Schwarze Menschen. Auf seinen Protest hin antworten sie nur, dass er Araber nicht wie sie kennen würde. Fanon macht hier sehr deutlich, dass es bei seinem Denken nicht einfach um Anti-Blackness geht, wie es die Afro-Pessimist*innen oft behaupten würden. Rassismus gegen Schwarze Menschen wird bei Fanon zwar als eine spezifische Unterform des Kolonialrassismus betrachtet, er betrachtet diese jedoch auch im Verhältnis zu weiteren Formen wie dem Antisemitismus und dem Rassismus gegen Nordafrikaner*innen. Zudem, und das ist ein grundlegender Unterschied, versteht Fanon Rassismus als eingelassen in die kapitalistische Produktionsweise (wenn auch nicht nur durch sie bestimmt), und nicht einfach als Ontologie.
Im Afro-Pessimismus übertrumpft Anti-Blackness quasi alle Ausbeutungs-und Unterdrückungsverhältnisse und die ontologische Trennung von Mensch und Sklave (den Schwarzen) wird als grundlegend für die Konstitution von Menschsein gesetzt. Das ist natürlich nicht nur ahistorisch, sondern politisch absolut fatal. Die Afro-Pessimist*innen stützen sich in Fanons Werk vor allem seine Betrachtung der psychoanalytischen und sexualisierten Begierdestrukturen, die sie als wesentlichen Teil von Anti-Schwarzen Herrschaftsverhältnissen ansehen. Ihre einseitige Fokussierung negiert Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis, das Fanon eigentlich analysiert. Fanon analysiert zudem koloniale Gewalt als wesentliche Methode zur Aufrechterhaltung kolonialer Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse, in denen Enteignung zentral ist, und versteht diese nicht einfach als essenzialistisch als »Anti-Schwarz«.
Das größte Problem am Afro-Pessimismus ist, dass er jegliche Form von politischer Solidarität ablehnt – insbesondere die radikale, kämpferische Solidarität, für die Fanon stand. Fanon war ein Kämpfer, der sich 1956 in Algerien aktiv engagierte und für einen radikalen, internationalen und multilateralen Internationalismus eintrat. Für die Afro-Pessimist*innen hingegen ist Solidarität kaum möglich, weil sie jede Solidarität auf eine Anti-Schwarze Grundlage reduzieren und so ausschließen.
Es gibt auch feministische Kritiken an Frantz Fanon. Worum geht’s da?
In »Schwarze Haut, weiße Masken« analysiert Frantz Fanon die Romanfigur der Schriftstellerin Mayotte Capécia und untersucht ihre Beziehungen zu weißen Männern. Darin erkennt er ihr Streben nach »Lactification« – dem Wunsch, weiß zu werden – im übertragenen Sinne von »milchig-weiß« – und wertet diesen Wunsch als verräterisch. Doch beim schwarzen Mann ist das gleiche Verhalten immer nachvollziehbar. Das hat eine gewisse Dimension von Misogynie. Wenn wir heute in die Karibik schauen – wenn zum Beispiel schwarze Arbeiterinnen versuchen, sich die Haut aufzuhellen – stellt sich die Frage: Wo setzt du an? Sagst du: Du verrätst dich selbst? Oder fragst du: Was sind eigentlich die gesellschaftlichen, strukturellen Verhältnisse, die ein Heller-Werden abverlangen? Fanon setzt da einen unterschiedlichen Maßstab an, und das wurde von antikolonialen Feminist*innen zu Recht kritisiert. Zugleich, Mayotte Capécia ging ein Verhältnis mit einem Vichy-Anhänger ein und verehrte diesen, daher ist Fanons Abneigung auf dieser Ebene nachvollziehbar. Auch in seinem Text »Algerien legt den Schleier ab«, in dem er analysiert, wie sich die Rolle des Schleiers als kulturellem und religiösen Symbol vor dem Hintergrund des revolutionären Widerstands gegen die französische Kolonialmacht verändert, lässt sich eine Ambivalenz erkennen. Zum einen betrachtet er die Handlungsmacht der algerischen Frau, zum anderen argumentiert er, dass diese praktisch frei wird, indem sie sich der nationalen Befreiung unterordnet. Und wir wissen, was auch das Problem daran war: Gleichheit im Rahmen der nationalen Befreiung – aber sobald es zur formalen Dekolonisation kommt, werden Geschlechterverhältnisse wieder zementiert. Fanon hat da eine Leerstelle.
Du hast mich dazu gebracht, »Für eine afrikanische Revolution« von Fanon zu lesen. Dort beschreibt er den französischen Kolonialismus unter anderem als eine strukturell rassistische und entmenschlichende Polizeiherrschaft. War Fanon ein Abolitionist wie Du?
Der materialistische Abolitionismus zielt nicht nur auf die Abschaffung einzelner Institutionen wie Sklaverei, Kolonialismus , Polizei oder Knäste ab, sondern auf die Abschaffung der zugrunde liegenden Produktionsweisen, Beziehungsstrukturen und Eigentumsverhältnissen, die diese Institutionen überhaupt erst hervorbringen und auf sie angewiesen sind. Das korrespondiert sehr stark mit Fanon.
Auch der Fokus auf unvermittelte Gewalt als Instrument des Kapitalismus ist bei Fanon und im Abolitionismus zentral.
Ghettoisierung, Apartheid, Polizei und Grenztechnologien sind für ihn zentrale Mittel, um ein kolonial ausbeuterisches, kapitalistisches System zu reproduzieren und aufrechtzuerhalten. Ebenso wie Abolitionist*innen hebt er immer wieder hervor, dass Formen der institutionalisierten Gewalt nicht nur da sind, um Ausbeutungsverhältnisse zu zementieren, sondern eine eigenständige, treibende Rolle spielen.
Zudem blickt Fanon nicht nur auf die organisierte Arbeiter*innenklasse. Auch das Lumpenproletariat und seine Kriminalisierung spielt für ihn in der antikolonialen Revolution eine zentrale Rolle – gerade diesen Aspekt heben Abolitionist*innen auch mit Bezug auf die sogenannte Überschussbevölkerung hervor.
Was lässt sich heute noch von Fanon lernen?
Erstens lässt sich Fanon auch als ein Faschismus-Theoretiker lesen. Es fällt auf, dass er und andere Schwarze Marxist*innen wie George Padmore, Claudia Jones, George Jackson oder Walter Rodney in aktuellen Faschismusanalyse-Debatten kaum auftauchen. Dabei beschreibt gerade Fanon sehr deutlich, wie das Regieren über brutale Gewalt eine zweigeteilte Welt erzeugt und aufrechterhält – was in der Faschismusanalyse als Doppelstaat bezeichnet wird.
Auch sein Fokus auf Grenzen und Polizei muss betrachtet werden, denn Grenzen und Polizei sind heute wesentliche Treiber von Faschisierung. Das sehen wir gerade unter anderem in Los Angeles und anderen Städten in den USA sowie an den Außengrenzen Europas. Hier handelt es sich um faschistische Geographien, und zwar nicht erst seit dem Erstarken rechter Parteien. Fanon machte deutlich, dass Liberalismus nicht den Gegensatz zum Faschismus darstellt.
Der zweite Punkt betrifft die Gewaltfrage: Gewalt entsteht niemals in einem Vakuum, sie ist schon vorher strukturell vorhanden. Eine radikale Kritik der Gewalt muss deshalb immer auch die strukturellen Gewaltverhältnisse thematisieren. Das gilt für heutige Situationen in Haiti oder Gaza, für Aufstände in Pariser oder Marseiller Vierteln, in Los Angeles oder bei Ausschreitungen in Berliner Schwimmbädern.
Der dritte und letzte Punkt betrifft Fanons Misstrauen gegenüber der Nation – ein sehr berechtigtes Misstrauen. Er hat bereits früh geschrieben, dass nach der Dekolonisierung schnell neokoloniale Verhältnisse folgen: Ermordungen radikaler Revolutionäre, die Herausbildung neokolonialer Strukturen und die tragende Rolle nationaler Eliten darin. Für ihn war Nationalismus nie ein Eigenzweck, sondern immer ein Mittel zum Internationalismus. Als radikaler Universalist setzte er auf eine Politik, die gegen Kapitalismus, Kolonialherrschaft und deren Verflechtungen mit einheimischen Eliten kämpft.
Kurz gesagt: Fanon stand für soziale Emanzipation und eine universelle Arbeiter*innen-Solidarität und nicht einfach für nationale Befreiung, er erkannte die Fallstricke dieser bereits sehr früh, und ich glaube, wir müssen da ansetzen, um über die Nation hinauszugehen.
