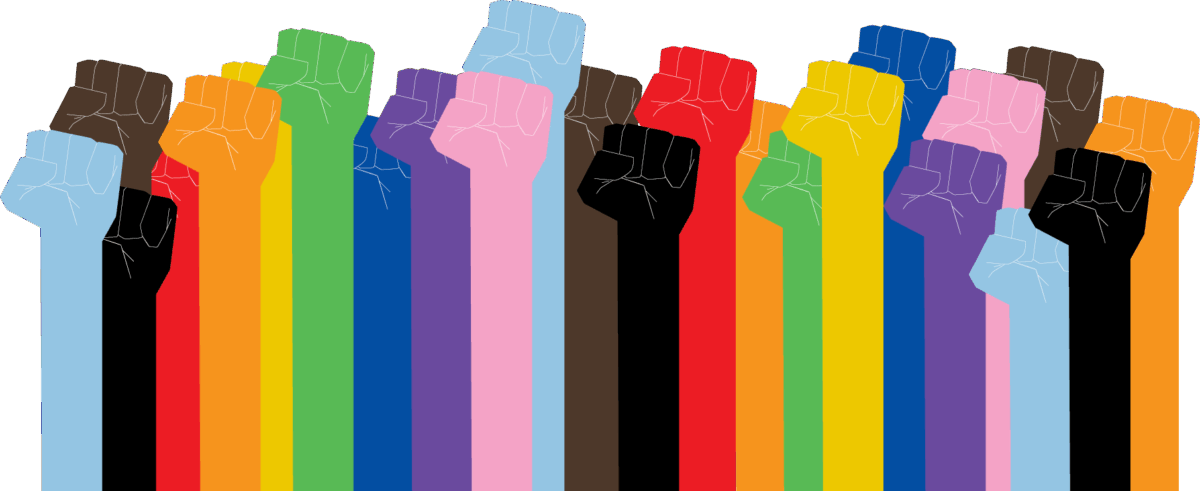Radikale Fürsorge
Wie ein queeres Kollektiv in Kenia finanzielle Hilfe und dekoloniale politische Bildung organisiert
Interview: Hêlîn Dirik

Der Trans Queer Fund (TQF) gründete sich 2020 im Kontext der Corona-Pandemie, um queere Menschen in Kenia in finanziellen Notlagen zu unterstützen. Im Gespräch erklärt Leila, seit 2023 Mitglied von TQF, warum die Arbeit auch nach der Pandemie weiterging und wie darin Zusammenhänge zwischen queerer Befreiung, Antiimperialismus und Antikapitalismus diskutiert werden.
Wie ist die Situation queerer Menschen in Kenia?
Leila: Kenia hat immer noch britische koloniale Gesetze, die gleichgeschlechtlichen Sex verbieten. Die Kriminalisierung von Homosexualität in Artikeln 162 und 165 des kenianischen Strafgesetzbuches stammt noch aus der Kolonialzeit. Heute verfolgen viele westliche queerfeindliche Organisationen wie Ordo Iuris in Polen, CitizenGo in Spanien, Alliance Defending Freedom in den USA und Familywatch International – allesamt mit viel Geld und Ressourcen ausgestattete Organisationen – neokoloniale, imperiale Interessen in Afrika. Sie machen anti-queere Lobbyarbeit und versuchen, Gesetze wie in Uganda oder Ghana durchzusetzen – zwei Staaten, die zuletzt sehr strenge Gesetze gegen Homosexualität eingeführt haben. Sie sind in ganz Afrika aktiv und operieren über meist religiöse Stellvertreter-Institutionen, in Kenia ist das zum Beispiel das Kenya Christian Professionals Forum. Sie unterstützen Gesetze wie das sogenannte Familienschutzgesetz, dessen Entwurf 2023 vom Abgeordneten Peter Kaluma vorgestellt wurde und das eine Verschärfung und Erweiterung der queerfeindlichen Gesetze vorsieht. Queerness wird dabei als Bedrohung der Familie oder afrikanischer und christlicher Werte dargestellt. In diesem queerfeindlichen Klima nehmen Diskriminierung und Ausgrenzung im Alltag zu. Vermieter*innen zwangsräumen etwa queere Menschen, die auf ihren Grundstücken wohnen, und Arbeitgeber*innen feuern Angestellte, nur weil diese sichtbar queer sind.
Warum wurde TQF gegründet?
Während der Corona-Pandemie verschlechterten sich die sozialen Bedingungen für queere Menschen drastisch. Arbeits- und Wohnungslosigkeit nahmen zu, viele Arbeitgeber*innen entließen ihre Angestellten, und weil queere Menschen in Kenia oft im informellen Sektor arbeiten, waren sie von all dem besonders stark betroffen. Es brauchte eine schnelle, unkomplizierte finanzielle Entlastung, und so begannen wir mit unserer Arbeit. Wir erkannten dabei früh, dass die Probleme nicht nur durch die Pandemie bedingt waren – die Tatsache, dass so viele queere Menschen arm sind, hat mit dem System zu tun. Und so entschieden wir uns, die Arbeit auch über die Pandemie hinaus weiterzuführen. Mittlerweile sind wir vierzehn Freiwillige und arbeiten in drei Gruppen – einem Kommunikationsteam, einem Fundraisingteam und einem Team, das politische Bildungsangebote organisiert.
Der Trans Queer Fund Kenya (TQF)
wurde 2020 gegründet und hilft queeren Menschen in Kenia in finanziellen Notlagen. Mit einem antikapitalistischen und antiimperialistischen Ansatz organisiert TQF auch politische Bildung und Events für die Community. Spenden sammelt der Fonds über Aufrufe in sozialen Medien (Instagram: @trans.queer.fund.ke).
Wie funktioniert die finanzielle Unterstützung konkret?
Im üblichen Zyklus starten wir damit, dass wir über einen Zeitraum von zwei Wochen Anfragen annehmen, meist über unsere Social-Media-Kanäle, manchmal auch per Mail oder Anruf. Die Antragstellenden sagen uns, was sie brauchen, zum Beispiel Geld für Essen, für Medikamente oder um die Miete zu bezahlen. Danach beginnt eine weitere zweiwöchige Phase, in der wir die Anfragen prüfen, Gelder sammeln und es an die Menschen auszahlen, die es brauchen. Die Spenden sammeln wir größtenteils über Aufrufe in den sozialen Medien. Da wir keine offiziell eingetragene Organisation sind, ist es schwer, an Förderungen zu kommen, weshalb wir hauptsächlich fundraisen. Im letzten Jahr ist die Höhe der angefragten Beträge allerdings stark gestiegen, weshalb wir aktuell mehr Zeit brauchen, um das Geld aufzutreiben. Wir müssen nach neuen Wegen suchen, damit dieses Hilfesystem weiterhin funktioniert. Wir schaffen es auch nicht immer, 100 Prozent von dem Geld auszuzahlen, das eine Person beantragt hat. Wir finden es wichtiger, alle Antragstellenden wenigstens teilweise zu unterstützen, statt einen Teil der Anfragen komplett abzulehnen.
Müssen Antragstellende irgendwelche Nachweise vorlegen?
Nein, außer etwas kommt uns verdächtig vor. Es gibt einige NGOs in Kenia, die finanzielle Unterstützung leisten, aber die Anträge sind meist mit vielen bürokratischen Hürden verbunden. Das wollen wir vermeiden – der Prozess soll zugänglich sein. Wir glauben den Antragstellenden grundsätzlich und verlangen keine Nachweise. Wir möchten nicht, dass sich Menschen gedemütigt fühlen oder retraumatisiert werden, weil sie bei der Antragstellung zum Beispiel Kontakt zu Verwandten aufnehmen müssen, die sie nicht unterstützen oder vor denen sie sich verstecken müssen. Und wir vermeiden auch das Strafen: Sagen wir, eine Person hat in einer Anfrage gelogen und 100 Euro Unterstützung beantragt, obwohl sie nur 50 braucht, oder hat mehrere Anfragen von mehreren Accounts gesendet. Statt die Person zu bestrafen, versuchen wir, verständnisvoll zu sein, das Gespräch zu suchen und ihr die Möglichkeit zu geben, das Verhalten zu reflektieren. Das ist auch Teil unserer Dekolonisierungsarbeit. Wir haben ein grausames System der Bestrafung geerbt – Dekolonisierung bedeutet für uns auch, diese entmenschlichenden Arten des Umgangs miteinander zu überwinden.
Unsere Arbeit darf sich nicht nur um Armut und Notlagen drehen – es gibt so viel queere Freude und queeren Widerstand.
Wie viele Menschen habt ihr bisher unterstützt? Und bekommt ihr auch Anfragen von Menschen außerhalb von Kenia?
Weil wir ein kleines Team aus Freiwilligen sind, fehlen uns die Kapazitäten, um die Daten umfangreich zu analysieren. Wir haben auch einige wiederholende Anfragen, weshalb wir nicht genau wissen, wie viele einzelne Personen wir bisher insgesamt unterstützt haben. Im letzten Zyklus zumindest waren es 196 Personen. 2024 haben wir über 10.000 Euro ausgezahlt und insgesamt gut über 1.000 Personen unterstützt. Aufgrund der strengen Gesetze in Uganda bekommen wir auch von dort Anfragen. Und aufgrund des Kriegs in Sudan kommen auch Anfragen von queeren Menschen in Geflüchtetencamps. Die meisten Anfragen kommen aus Ostafrika. Aber wir haben beispielsweise auch Menschen in der EndSars-Bewegung gegen Polizeigewalt in Nigeria 2020 oder Feminist*innen in Namibia während der ShutItAllDown-Proteste gegen geschlechtsspezifische Gewalt unterstützt.
Du hast erwähnt, dass ihr auch politische Bildung organisiert. Was ist dabei eure Vision?
Wir wollen das Leben von queeren Menschen in Kenia verbessern, nicht nur durch finanziellen Support. Wir sind der Ansicht, dass sich unsere Arbeit nicht nur auf Notlagen und Leid konzentrieren darf. Es gibt so viel queere Freude und queeren Widerstand – wir wollen, dass queere Menschen das bekommen, was sie brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen. Wir organisieren Veranstaltungen mit trans und queeren Künstler*innen mit, wir organisieren Treffs für die Community und gemeinsame Aktivitäten wie Wandern, wir helfen, sicheres Wohnen für queere Menschen zu organisieren. Und wir machen politische Bildung, das auf einem antikapitalistischen, antiimperialistischen und antipatriarchalen Verständnis basiert. Die politische Bildung soll eine Basis schaffen, um die Zusammenhänge zwischen den eigenen Problemen und dem System herzustellen, statt die Schuld für Ungerechtigkeit, Verarmung und Ausgrenzung bei sich selbst zu suchen.
Inhalt unserer Bildungsarbeit ist zum einen der koloniale, imperialistische Kontext, dem wir als Afrikaner*innen gegenüberstehen. In präkolonialen Zeiten existierten queere Afrikaner*innen, aber Kolonisierung vernichtete indigene Identitäten, einschließlich queere indigene Identitäten. Neokoloniale, westlich-finanzierte Kampagnen, die sich auf religiöse Werte berufen, setzen diese Bestrebungen heute fort, indem sie aktiv gegen queere Menschenrechte kämpfen. Hinzu kommt die nationalistische Instrumentalisierung kultureller Werte gegen Queerness, bei der Queerness als »unafrikanisch« gesehen und mit Verrat an der eigenen Kultur gleichgesetzt wird. Das Cis-Hetero-Patriarchat ist tief in unserer Kultur und unseren Narrativen verankert. Und natürlich Kapitalismus: Jetzt ist wieder Pride Month und wir sehen zu, wie kapitalistische Unternehmen sich an Queerness bereichern, ohne etwas an den materiellen Lebensbedingungen queerer Menschen zu verbessern. Unsere hauptsächliche Arbeit ist die finanzielle Unterstützung, aber wir wollen zu all diesen Verhältnissen – Imperialismus, Nationalismus, Cis-Hetero-Patriarchat und Kapitalismus – auch ein politisches Bewusstsein schaffen. Wir glauben, dass queerer Widerstand sich inhärent gegen das System richtet und darin besteht, von einer Welt zu träumen, in der Menschen und die Erde wertgeschätzt werden. Es gibt keine queere Befreiung ohne die Abschaffung dieser Herrschaftssysteme.