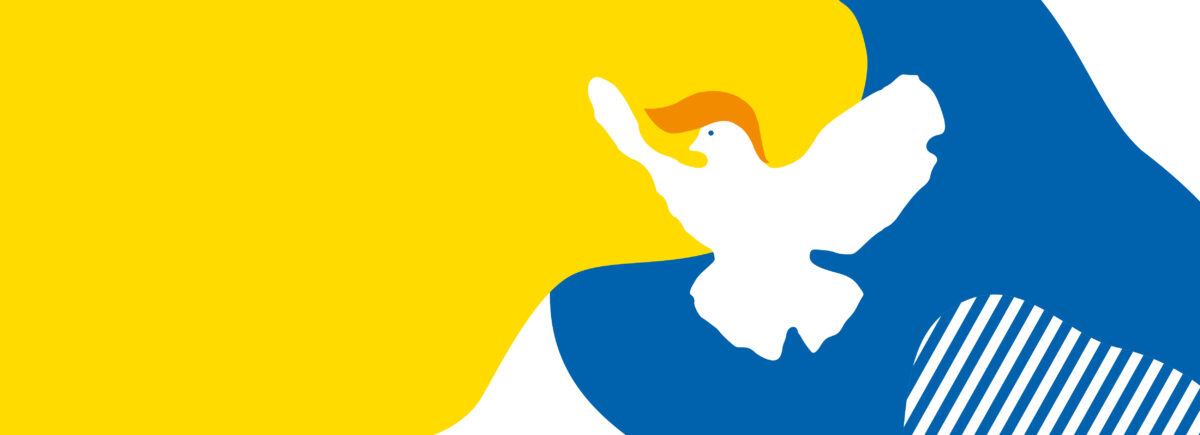Wie geht es den Deserteuren?
Rudi Friedrich unterstützt Männer, die sich dem Ukrainekrieg entziehen – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Georgien, wohin Zehntausende geflohen sind
Interview: Nelli Tügel

Der Verein Connection e.V. unterstützt seit Jahrzehnten Kriegsdienstverweigerer, Militärdienstentzieher und Deserteure (1), seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine vor drei Jahren verstärkt auch solche aus Russland und der Ukraine. Viele Männer im militärpflichtigen Alter haben sich in Staaten wie Armenien, Kasachstan oder Georgien geflüchtet, auch weil die Wege nach Westeuropa oft versperrt sind. Im Oktober 2024 war eine Delegation von Connection e.V. gemeinsam mit der Hilfsorganisation medico international, die auch Gruppen vor Ort unterstützt, eine Woche in Georgien.
Sie waren im vergangenen Herbst in Georgien. Warum ausgerechnet dort?
Rudi Friedrich: Wir haben Gruppen in Georgien besucht, die wir ohnehin unterstützen. Hintergrund ist, dass viele Deserteure aus Russland unter anderem nach Georgien gegangen sind, die Zahlen schwanken stark, aber es sind sicher einige Zehntausend nach wie vor dort. Hinzu kommen ukrainische Verweigerer, von denen ebenfalls einige nach Georgien gegangen sind. Wir hatten daher sowieso schon Kontakte zu verschiedenen Gruppen in Georgien, insbesondere zur Bewegung für Kriegsverweigerung Russland, die unter anderem bei Visafragen helfen, Act for Transformation, die dort ein Büro aufrechterhalten und ebenfalls Leute darin beraten, Visa für Westeuropa zu beantragen, auch für Deutschland, was extrem schwierig ist. Sowie zu Idite Lesom, die Deserteure aus Russland dabei unterstützen, aus dem Land rauszukommen, etwa 1.000 Deserteuren ist das bislang mit ihrer Unterstützung gelungen.
Was haben sie über die Lebensumstände dieser Menschen, die da aus Russland oder auch aus der Ukraine gekommen sind, um dem Krieg zu entkommen, erfahren?
Wir haben beispielsweise ein sogenanntes Safe House, Antizona, besucht. Das ist eine selbstorganisierte Gruppe von etwa 25 Leuten, die Dissident*innen und Flüchtlingen eine Möglichkeit bieten, dort für einige Zeit zu wohnen. Die haben kurz nach Kriegsbeginn angefangen und wenden sich an Leute sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine. Ihr Anspruch war eigentlich, dabei auch politisch aktiv zu sein und etwa Kurse und Seminar anzubieten. Sie mussten dann feststellen, dass auch aufgrund der hohen Zahl der Flüchtlinge, die aus Russland und der Ukraine nach Georgien gekommen sind, die Mieten in Georgien sehr stark hochgegangen sind. Sie haben nur ein Haus gefunden, das außerhalb der Hauptstadt liegt. Dort sind sie jetzt, als Unterkunft. Aber die Idee, da auch politisch wirklich präsent zu sein, haben sie verworfen, weil sie dafür einfach keine Räume gefunden haben. Das wirft ein kleines Schlaglicht auf die soziale Situation der Geflüchteten in Georgien.
Einige Gruppen, die mit russischen Deserteuren arbeiten, haben Georgien inzwischen verlassen, weil sie eine Auslieferung nach Russland fürchten.
Sie befinden sich aber auch aus anderen Gründen in einer recht prekären Lage: Menschen mit russischem Pass dürfen zwar ein Jahr lang in Georgien bleiben. Danach müssen sich aber mindestens für einen Tag ausreisen und dann wieder einreisen, damit der Aufenthaltsstatus sich verlängert. Dafür muss man aber wieder nach Georgien reinkommen. Und wir haben vor Ort erfahren, dass 2024 tatsächlich einige bei der Wiedereinreise abgewiesen worden sind, entweder von den russischen Grenzbehörden, die sie nicht wieder rausgelassen haben, oder von den georgischen Grenzbehörden, die sie nicht haben einreisen lassen.
Wie sieht es denn mit der Unterstützung für Migrant*innen aus der Ukraine und aus Russland aus?
Wir hatten unter anderem Kontakt zu einer Bischöfin von einer Friedenskirche, die uns berichtet hat, dass es am Anfang des Krieges, als ukrainische Geflüchtete gekommen sind, eine enorm große Unterstützung gab, auch aus der Bevölkerung, aber das hat wohl stark abgenommen.
Sehen das die Gruppen, mit denen Sie in Georgien kooperieren, auch so?
Auch die Gruppen, die wir besucht haben, bestätigen das und sagen, ja, wir haben Unterstützung bekommen, aber die ist längst weg. Sie sehen ihre Situation als prekär an, und haben auch berichtet, dass etwa zunehmend antirussische Wandschmierereien oder ähnliches zu sehen sind.
Was ihnen aber noch größere Sorgen bereitet, sind die jüngsten Gesetzesänderungen der georgischen Regierung. Zum einen das »Gesetz zur Transparenz ausländischer Einflussnahme«, das im Juni 2024 beschlossen wurde, zum anderen das LGBTQ-Gesetz vom Oktober 2024, das die Rechte von LGBTQ einschränkt und unter anderem Schwulsein als Inzest definiert. Ein größerer Teil der geflüchteten Russ*innen versteht sich als LGBTQ, dieses Gesetz ist für sie natürlich eine Bedrohung. Beide Gesetze habe dazu geführt, dass viele der russischen Organisationen, die Dissident*innen und Flüchtlinge aus Russland in Georgien unterstützt haben, gar nicht mehr in Georgien aktiv sind.
Was sieht denn das erwähnte neue »Gesetz zur Transparenz ausländischer Einflussnahme« vor?
Das orientiert sich am russischen Gesetz über »ausländische Agenten« von 2012. Zwar wurde der Passus, der »ausländische Agenten« definiert aus dem georgischen Gesetz herausgenommen. Aber das Problem ist, dass es neue Strafzumessungen gibt, die es vorher nicht gab und für die nun Georgien Leute, für die es in Russland ein Strafverfahren gibt, ausliefern kann – denn das geht nur, wenn es in Georgien einen ähnlichen Straftatbestand gibt. Daraufhin sind einige der Organisationen, die mit russischen Deserteuren arbeiten, aus Georgien raus, weil sie anders als vorher eine Auslieferung fürchten mussten. Idite Lesom etwa ist inzwischen aus Georgien weg und nach Westeuropa gegangen.
Was können wir in Ländern der Europäischen Union tun, um die Geflüchteten in Georgien oder auch anderen Staaten, in denen viele sich in Sicherheit gebracht haben, wie Kasachstan oder Armenien, zu unterstützen?
Zum einen den Gruppen vor Ort mit Geld und Ressourcen unter die Arme greifen. Dafür haben wir unsere Object War-Kampagne, in der sich 100 Organisationen aus über 20 Ländern zusammengeschlossen haben.

Rudi Friedrich
unterstützt seit den 1980er Jahren Kriegsdienstverweigerer, Deserteure und Militärdienstentzieher. 1993 gründete er den Verein Connection e. V. mit, dessen Geschäftsführer er seither ist.
Foto: privat
Dann ist da das Visaproblem. In Deutschland gab es nach Kriegsbeginn ja seitens der Bundesregierung die Ansage, dass russische Dissident*innen, die in Russland aktiv waren und Verfolgung befürchten müssen, ein Visum bekommen. Das betraf seitdem etwa 1.500 Russ*innen, immerhin. Zum anderen hatte das Innenministerium damals angewiesen, dass Deserteure aus Russland, sollten sie nach Deutschland kommen, einen Flüchtlingsschutz erhalten sollen. Das funktioniert unseres Wissens nach. Aber: Es funktioniert eben nur für Deserteure, ausdrücklich nicht für Militärdienstentzieher, also Männer, die rechtzeitig weg sind, bevor sie eingezogen werden konnten. Das sind viel mehr als solche, die von der Front desertiert sind, aber die bekommen eben in der Regel keinen Flüchtlingsschutz.
Dazu hat Ende Januar das Verwaltungsgericht Berlin in zwei Fällen von russischen Männern, die in Deutschland leben, entschieden, dass Wehrdienstpflichtige aus Russland subsidiären Schutz erhalten müssen. Was bedeutet dieses Urteil?
In der Tat gab es Ende Januar 2025 zwei bemerkenswerte Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes Berlin. In beiden Fällen wurde ein Schutz für russische Militärdienstpflichtige anerkannt. Dafür wurden verschiedene Gründe angeführt. Erstens sei es ihnen nicht wirklich möglich, das bestehende Recht auf Kriegsdienstverweigerung in Russland wahrzunehmen. Zweitens drohe ihnen selbst bei einer Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer der Einsatz im Militär. Drittens könnten sie als Militärdienstpflichtige auch in den von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebieten der Ukraine eingesetzt werden. Die Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig. Es ist noch offen, wie das am Ende ausgeht. Aber es gibt dennoch Hoffnung, dass es Bewegung gibt. Letztlich sind wir der Auffassung, dass alle diejenigen, die sich einer Dienstverpflichtung in einem völkerrechtswidrigen Krieg verweigern – und damit dem Völkerrecht nachkommen – Schutz erhalten müssen.
Anmerkung:
1) Militärdienstentzieher entziehen sich einer Einberufung rechtzeitig. Deserteure sind bereits Einberufene, die sich dann aus dem Kriegsdienst entfernen. Kriegsdienstverweigerer wiederum sind jene, die eine Einberufung erklärtermaßen aus religiösen oder politischen Gründen nicht befolgen.