Nationales Wir-Gefühl
80 Jahre nach dem 8. Mai 1945 mahnt nicht nur der Bundespräsident die Deutschen
Von Jens Renner
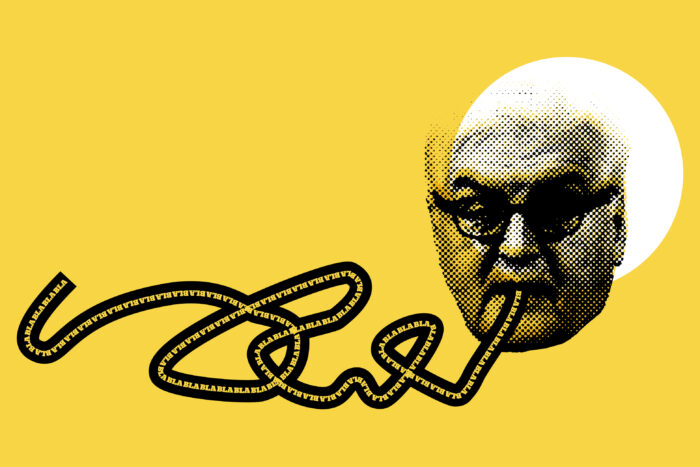
Staatsoffizielle Ansprachen zu historischen Feiertagen werden in der Regel sorgfältig vorbereitet. Das war auch in diesem Jahr so zum 80. Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung vom Nationalsozialismus. Wie zu erwarten war, begann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) seine Rede in der Feierstunde im Bundestag mit der deutschen Niederlage, der Trümmerlandschaft, den Flüchtlingstrecks und den demoralisierten Wehrmachtssoldaten. Etwas später folgten die 60 Millionen Kriegstoten, die sechs Millionen Opfer der Shoah, schließlich die Befreiung: »Am 8. Mai 1945 wurden wir befreit.«
Diese Aussage stieß in der BRD jahrzehntelang bis in die politische Mitte hinein auf heftige Ablehnung. Erst ab 1985 wurde der Satz ein Standard offizieller Gedenkreden. Damals war es der ehemalige Wehrmachtsoffizier, nunmehr Bundespräsident Richard von Weizsäcker (CDU), der auch große Teile seiner eigenen Partei mit dieser Erkenntnis provozierte. Noch ein Jahr zuvor, zum 40. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie (D-Day), hatte Helmut Kohl verkündet: »Es ist für den deutschen Bundeskanzler kein Grund zum Feiern, wenn andere ihren Sieg in einer Schlacht begehen, in der Zehntausende Deutsche elend umgekommen sind!«
Während Weizsäcker seinerzeit den Mut hatte, sich mit den eigenen Leuten anzulegen, blieb Steinmeier am diesjährigen 8. Mai beim mittlerweile Bewährten: Dank an die Befreier (»Amerikaner, Briten, Franzosen«), aber auch an die »Russen, Ukrainer, Weißrussen« in der Roten Armee, die Auschwitz befreite; Dank für das »Wunder der Versöhnung« mit ehemals feindlichen Nachbarn und mit Israel; Selbstlob für den Umgang mit der deutschen Verbrechensgeschichte und die aus »zwei Diktaturen« gezogenen Lehren. All das hätte auch eine KI locker zusammenstellen können. Vermutlich hat man aber im Bundespräsidialamt doch lieber den hauseigenen Expert*innen vertraut.
»Doppelter Epochenbruch«
Was wird bleiben von Steinmeiers Rede? Vielleicht die Formulierung vom sich vollziehenden »doppelten Epochenbruch«, einer schlagzeilentauglichen Neuschöpfung. Gemeint ist »der Angriffskrieg Russlands und der Wertebruch Amerikas«. Letzterem, ausgelöst durch die »Faszination des Autoritären« und andere »populistische Verlockungen«, begegnet Steinmeier lediglich mit mahnenden Worten. Sehr viel handfester klingt sein Programm gegenüber Russland. »Wir müssen alles tun, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, um Putins Landnahme aufzuhalten.«
Landnahme? Laut Wörterbuch bedeutet der keineswegs gängige Begriff so viel wie »das Inbesitznehmen von Land durch Besiedlung«. Kommen bald wieder die Russen nach Berlin? Und bleiben? Bis weit in die 1960er Jahre hinein war in der Bundesrepublik die vermeintliche Gefahr aus dem Osten allgegenwärtig. Personifiziert wurde sie, etwa auf Wahlplakaten der CDU, durch zähnefletschende Rotarmisten mit »asiatischen« Gesichtszügen – eine Motivwahl mit Tradition: In seiner letzten Rundfunkansprache hatte Reichspropagandaminister Josef Goebbels zum Widerstand gegen den »Mongolensturm« aufgerufen. Das war im April 1945, als die deutsche Niederlage längst feststand.
Steinmeier will keinen Krieg, er will »nur« aufrüsten: »Wir müssen militärisch stärker werden, aber nicht, um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern.« Erst so werde Diplomatie glaubhaft und aktive Außenpolitik jenseits eigennütziger Machtinteressen möglich: »Wo immer wir von Nutzen sein können, da sollen wir uns engagieren. Deutschland wird gebraucht, um um Frieden zu ringen, wo er verloren gegangen ist. Auch das ist der Auftrag des 8. Mai.« Die gewollt nebulöse Formulierung besteht keinen Faktencheck: Wo bitte »ringt« Deutschland um Frieden?
Wichtiger als Steinmeiers Routine-Rede ist der Forderungskatalog des Arbeitgeberpräsidenten: Sozialkürzungen und ein Pflichtjahr, am besten beim Militär.
Der größere Teil von Steinmeiers Rede gilt nicht der Befreiung, sondern dem, was danach kam: der Freiheit! Auch diese Gewichtung ist alles andere als originell. Vorreiter war hier Italiens rechter Ex-Premier Silvio Berlusconi. Seine Rede vom 25. April 2009 wird von der italienischen Rechten, namentlich Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, immer wieder als richtungweisend zitiert: Man solle doch aus dem nationalen Feiertag zur Erinnerung an die Befreiung (liberazione) einen zur Feier der Freiheit (libertà) machen – zum Zwecke der nationalen Versöhnung der feindlichen Lager von damals. Was darauf hinausliefe, Faschismus und Antifaschismus moralisch auf eine Stufe zu stellen – ein geschichtsrevisionistisches Projekt, an dem in Italien seit Jahrzehnten auch Kräfte der bürgerlichen Mitte maßgeblich beteiligt sind.
Das falsche Wir
Es wäre unfair, Steinmeier ähnliche Ambitionen zu unterstellen. Denn immerhin grenzt er sich, wenn auch ohne sie ausdrücklich zu nennen, von der AfD ab. Möglichst viele ihrer Anhänger*innen will er zurückgewinnen »für unsere Demokratie«. Wie das gehen könnte, sagt er nicht. Schon gar nicht kritisiert er den Rechtsschwenk der in Deutschland Regierenden oder mahnt den amtierenden Abschiebeminister, doch wenigstens die Gesetze einzuhalten. Die Liste der Themen, die Steinmeier keine Erwähnung wert sind, ist lang. Von Rassismus, Armut oder sozialer Spaltung zu sprechen, würde nur die »unglaubliche Erfolgsgeschichte eines Landes« stören, »das nach dem totalen Zusammenbruch … zu Freiheit, wirtschaftlicher Stärke und Wohlstand gekommen ist«, international respektiert wird usw. Fehlt nur noch der CDU-Wahlkampfslogan von 1987: »Weiter so, Deutschland!« Kurz nach dem Selbstlob endet die Rede mit einem dreifachen Wir: »Ja, wir sind alle Kinder des 8. Mai. Schützen wir unsere Freiheit! Schützen wir unsere Demokratie!«
»Wir« ist das von Steinmeier mit Abstand am häufigsten verwendete Wort. Wir (die Deutschen des Jahres 2025?) sind die Guten, weil wir aus der Geschichte gelernt haben, wir leben im Wohlstand und schützen die Demokratie. Dass er darunter etwas ganz anderes versteht als etwa Heidi Reichinnek in ihrer jüngsten Parteitagsrede, versteht sich von selbst.
Ist das alles zu viel Aufmerksamkeit für eine vorhersehbare, inhaltlich letztlich belanglose Rede? Vielleicht, und das nicht nur, weil es zeitnah Wichtigeres gab, darunter die Merz- und die Papst-Wahl. Zumindest in ihren Wirkungen bedeutsamer als Steinmeiers Routine-Auftritt war aber auch eine andere, öffentlich kaum wahrgenommene Wortmeldung aus derselben Woche. Nachlesbar ist sie im Wirtschaftsteil der Süddeutschen Zeitung vom 5. Mai, wo Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in einem längeren Interview die Erwartungen seiner Klasse an die neue Bundesregierung formuliert.
Zu Dulgers Forderungskatalog gehören die Senkung der Renten und der Sozialabgaben, ein Pflichtjahr für alle, am besten beim Militär, denn »wir brauchen jeden wehrfähigen Mann und jede wehrfähige Frau«. Entscheidend aber sei, »dass das Arbeitsvolumen der Beschäftigten nicht zurückgeht«. Mindestlohn per Gesetz wäre eine »Kampfansage an die Sozialpartner«, und höhere Steuern für Reiche könne nur fordern, wer eine »Sozialneiddebatte« wolle. Auf die Selbststeuerung der Wirtschaft über Angebot und Nachfrage, von Adam Smith (1723-1790) beschrieben mit dem Bild von der »unsichtbaren Hand des Marktes«, will Dulger sich dabei offensichtlich nicht verlassen. Unerlässlich ist für ihn die persönliche Kommunikation mit »handlungsfähigen und lösungsorientierten Ministern«, gern auch aus der SPD. Mit Friedrich Merz hätten er selbst und seinesgleichen schon viele gute Gespräche geführt. Ergebnis: »Er hat die Dinge verstanden, er weiß, was dieses Land braucht.«
Das weiß auch Oliver Georgi, stellvertretender Leiter für Nachrichten und Politik Online bei der FAZ. In deren Sonntagsausgabe vom 11. Mai verbreitet er »trotzigen Optimismus«. »Lasst Merz erst mal regieren«, fordert er schon in der Artikelüberschrift, denn: »Wer bei Sinnen ist, der wünscht dieser Regierung nur das Beste.« Die soll mal schnell loslegen: »Aufstehen, Krone (?) richten – und dann an die Arbeit, mit einem patriotischen Pragmatismus, der alte Verletzungen vergisst und neue Gemeinsamkeiten sucht …« Das gilt natürlich nicht nur für die Regierenden, sondern auch für »uns alle«. Wer das nicht begreife – wie etwa die SPD-Linke – müsse schleunigst belehrt werden, »was das Wort ›staatstragend‹ bedeutet«. Dann klappt das schon mit Deutschland: »Muss ja. Und wird schon!«
In den 1990er Jahren wurde in antideutschen Kreisen als Motiv ähnlicher Appelle Sehnsucht nach der Volksgemeinschaft diagnostiziert. Wie fast alle NS-Analogien war das schon damals falsch und wäre es auch heute. Aber wenn das deutsche Staatsoberhaupt, der Sprecher des Großkapitals und das Zentralorgan der Bourgeoisie unisono zum nationalen Schulterschluss aufrufen, ist Vorsicht geboten – und die Bereitschaft, dem falschen, klassenübergreifenden nationalen »Wir« ein ganz anderes, entschieden unpatriotisches kollektives Subjekt entgegenzusetzen. Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht. Der Horror der Staatstragenden – eine instabile Regierung, die schon vor dem Start Schwächen zeigte – könnte Chancen bieten. Muss ja. Wird schon?