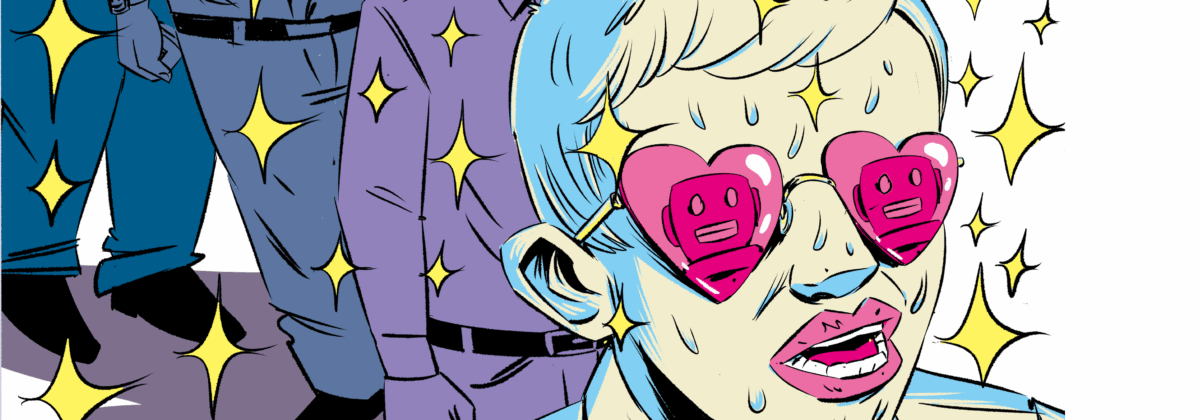Mensch, Maschine!
Dass neue Technologien mit Hoffnungen und Ängsten aufgeladen werden, gehörte schon immer zum Kapitalismus
Von Christian Frings
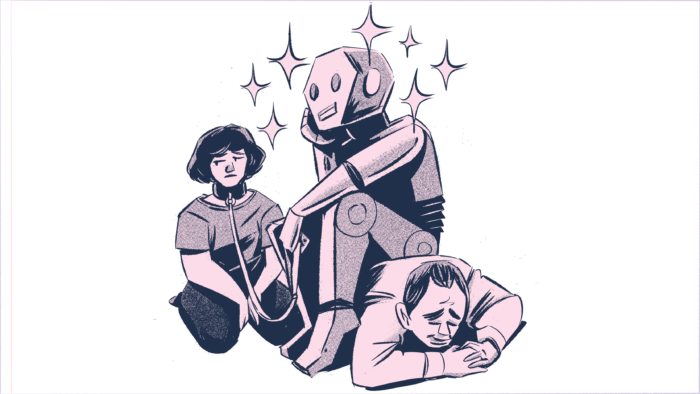
Seit der ersten industriellen Revolution vor etwa 250 Jahren sind wir mit einem Prozess der permanenten Erneuerung von Technologien konfrontiert, wie es ihn in dieser Geschwindigkeit nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gegeben hatte. Und seit dieser Zeit werden neue Technologien abwechselnd mit utopischen Hoffnungen und dystopischen Ängsten verbunden. Beide Reaktionen schreiben der Maschinerie eine übermenschliche Macht zu, die an religiöse Vorstellungen von einem allmächtigen Gott erinnert.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die »Maschinenfrage« zum beherrschenden Thema in der Öffentlichkeit und der ökonomischen Literatur geworden – vor allem, als die Arbeiter*innen anfingen, sich durch die Zerstörung von Maschinen (Luddismus) gegen ihre Verdrängung aus und Dequalifizierung in der Produktion zu wehren. Gleichzeitig meinten findige Tüftler*innen aus der Arbeiter*innenklasse, das Elend mit neuen Maschinen beseitigen zu können. Eine der ersten digital gesteuerten Maschinen, der mit Lochstreifen gesteuerte Jacquard-Webstuhl, wurde vom Sohn eines Seidenwebers in Lyon 1805 entwickelt. Als Napoleon versuchte, die Maschine per Regierungsdekret durchzusetzen, revoltieren die Weber, weil nicht sie in den Genuss der gesteigerten Produktivität kamen.
Computer des »Schweinesystems«
In den USA waren sich in den 1920er-Jahren alle Sozialist*innen und Kommunist*innen darin einig, dass mit der Einführung des Fließbands in der Autoproduktion das Ende des Klassenkampfs und der Arbeiter*innenbewegung gekommen sei. Mit dieser disziplinierenden und kontrollierenden Technologie sei das Kommando des Kapitals in der Produktion über die durch das Band vereinzelten Arbeitskräfte unüberwindbar geworden. Währenddessen reisten Gewerkschafter aus Deutschland nach der gescheiterten Novemberrevolution in die USA und berichteten begeistert von dem durch Taylorismus und Fordismus möglich gewordenen Massenkonsum, wie etwa Fritz Tarnow 1928 in »Warum arm sein?«.
Als ich Mitte der 1980er-Jahren meinen ersten PC kaufte, um einfacher Texte und Flugblätter schreiben zu können, musste ich ihn im neutralen Karton ins besetzte Haus schmuggeln. Das Plenum hätte diese Technologie des »Schweinesystems« in unserem autonomen Freiraum nicht geduldet. Zehn Jahre später, als Internet und E-Mail boomten, schwärmte die Szene von den neuen Möglichkeiten der Vernetzung und des globalen Informationsaustauschs.
Und jetzt wabern »Plattformkapitalismus« und »Künstliche Intelligenz« durch die Debatten, die für die einen das »Zeitalter des Überwachungskapitalismus« und einen »Technofeudalismus« bedeuten, während andere in den digital gesteuerten Lieferketten von Walmart und Amazon Blaupausen für eine sozialistische Planwirtschaft erkennen.
Die vom Kapital entwickelten Technologien sind Resultate, Mittel und Medium von Klassenkämpfen, nicht von demokratischen Entscheidungen.
In der philosophischen und sozialwissenschaftlichen Literatur ist es mittlerweile zu einem Topos geworden, auf diese Polarisierung zwischen utopischen und dystopischen Einschätzungen von Technologien hinzuweisen – gerne mit der abgegriffenen biblischen Formel von »Segen oder Fluch«. Das aufgeklärte Bürgertum antwortet auf diese Paradoxie meistens mit dem beruhigenden Hinweis, dass Technologien »an und für sich« gesellschaftlich neutral seien und es nur um die Frage ihrer Anwendung gehe, über die schließlich im demokratischen Dialog entschieden werden könne.
Aber im Kapitalismus ist die Maschinerie immer ein Moment dieser merkwürdigen Macht des Kapitals, die sich als fetischhafter Selbstlauf von ökonomischen Sachzwängen darstellt, als ein »stummer Zwang der ökonomischen Verhältnisse« gegenüber den atomisierten Individuen. Die politische Verfasstheit der Demokratie beruht auf einer Gesellschaft des Besitzindividualismus und der Konkurrenz, die daher auch nicht durch einen demokratischen Dialog verändert werden kann, ohne diese Staatsform selbst aufzuheben. Die vom Kapital entwickelten Technologien sind Resultate, Mittel und Medium von Klassenkämpfen, nicht von demokratischen Entscheidungen.
Lebendige und tote Arbeit
Die Verdinglichung der Macht des Kapitals und die Aufrechterhaltung dieser Verselbstständigung stützen sich ganz wesentlich darauf, dass sich alle Kräfte der gesellschaftlichen, kombinierten und kooperierenden lebendigen Arbeit als die Macht von toter Arbeit, von leblosen Dingen, von Maschinen darstellen. Für seine Reproduktion ist das Kapital auf die permanente Steigerung der Produktivkraft angewiesen – quantitativ und qualitativ. Quantitativ, indem die Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft gesenkt werden können (was Marx die Produktion des »relativen Mehrwerts« nennt), und qualitativ durch die ständige Einführung ganz neuer Gebrauchswerte wie Autos, Waschmaschinen, Smartphones, Schokoriegel oder Netflix-Serien, die uns bei Laune halten und die Segnungen des Kapitalismus verherrlichen sollen.
Aber innerhalb der Produktion müssen dieselben Technologien und die Art ihres Einsatzes auch das Kommando des Kapitals über die lebendige Arbeit absichern – Produktivität als scheinbar rein technische Dimension und die scheinbar rein gesellschaftlichen Machtverhältnisse lassen sich nicht trennen. Die Macht entsteht gerade daraus, dass aufgrund der Enteignung von den Produktionsmitteln im Lohnarbeitsverhältnis alle Kräfte und die Kreativität der lebendigen Arbeit in mystifizierter Weise als Kräfte des Kapitals erscheinen. Daher verbinden sich Technologien mit allen Machtverhältnissen, die für die Reproduktion kapitalistischer Klassenverhältnisse unerlässlich sind, und verstärken sie – seien es die geschlechtlichen Machtverhältnisse durch die Zuschreibung der Technik als männliche Domäne oder die Verfestigung kolonialer und neo-kolonialer Ausbeutungsverhältnisse durch das technologische Monopol der Metropolen im kapitalistischen Weltsystem.
Diese Verkehrung ergibt sich nicht nur naturwüchsig aus dem Charakter der kapitalistischen Produktionsweise, sie wird vom Kapital offensiv propagiert, um die Arbeiter*innenklasse in ihre Schranken zu weisen (zu den immer wieder aufkommenden Träumen bzw. Drohungen von der endgültigen Automatisierung oder der »menschenleeren Fabrik« siehe die erhellenden Beiträge von Judy Wajcman und Karsten Uhl in »Marx und die Roboter«, Dietz Verlag Berlin 2019).
Marx und die Spinnmaschine
Selbst Marx, der die hier skizzierte Analyse der Macht des Kapitals entwickelt hat, ließ sich zuweilen von der Propaganda dieser Macht in die Irre führen. Bei der Beschreibung der höchst entwickelten Automatisierung seiner Zeit, der vom Kapital übermütig als »self actor« bezeichneten Spinnmaschine, stützte er sich mangels besseren Wissens auf die Behauptungen in den Verkaufsprospekten der Maschinenhersteller, die den Unternehmern versprachen, mit dieser Maschine könnten sie die Aufsässigkeit der Arbeiter*innen in der Produktion endgültig unterdrücken. Die lebendige Arbeit, so folgerte Marx, sei damit zu einem bloßen »Anhängsel der Maschine« geworden. In Wirklichkeit wurde diese Technologie zur Machtbasis einer starken Arbeiter*innenbewegung, weil sie auf hochqualifizierte Maschinenbediener*innen angewiesen war. Und ebenso entstand aus dem Fließband in den USA eine neue Arbeiter*innenmacht, nachdem in den wilden Sitdown-Streiks im Winter 1936/1937 bei General Motors entdeckt worden war, wie anfällig das gesamte verkettete Produktionssystem gegenüber einzelnen Blockaden des Fließbands geworden war.
Der aktuelle Hype um die KI liest sich wie eine ähnlich großmäulige Drohung gegenüber der Arbeiter*innenklasse, mit der die in Technologie geronnene massenhafte gesellschaftliche Arbeit als die übermenschliche Macht eines unangreifbar gewordenen Kapitals dargestellt werden soll. Zu dieser Mystifizierung von Technologie gehört auch die Tendenz in Teilen der in der Krise steckenden Ökologiebewegung, die eigene Ohnmacht durch das Hoffen auf technische Lösungen – von Atomkraft über »grünen Wasserstoff« bis »Geoengineering« wie Karbonspeicherung – zu kompensieren und damit letztlich den Glauben an einen grünen Kapitalismus zu schüren. Hoffnungsvoller erscheint es da, wie sich die mit dem Label »Gen Z« versehene globale Jugendrevolte neue Technologien als Medium einer antikapitalistischen Macht aneignet.

Maik Banks
macht sequentielle Kunst und arbeitet zurzeit an einer Comic-Biografie über die Anarchistin Emma Goldman. Maik hat die Illustrationen zu diesem Schwerpunkt angefertigt und zeichnet auch sonst regelmäßig für ak und andere Medien. Online ist er zu erreichen unter www.maikbanks.com, auf Instagram unter @maikbanks und für Patreon-Unterstützer*innen auf www.patreon.com/maikbanks.