»Die Zeit ist gekommen«
Im Mai versuchte die Friedensbewegung in Israel im Angesicht des Gazakriegs einen Neustart
Von Nane G.
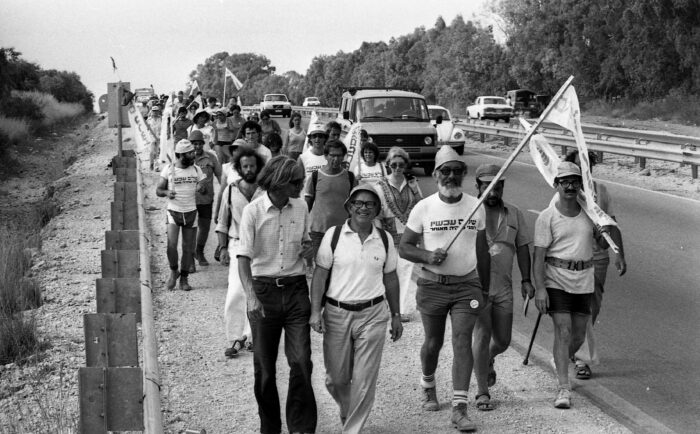
Der Saal des Kongresszentrums Binyanei HaUma in Westjerusalem ist voll. Heute, Anfang Mai, findet hier der »People’s Peace Summit« mit mehr als 5.000 Teilnehmenden statt. Auf einem großen Banner steht auf Hebräisch: »Die Zeit ist gekommen. Frieden ist die einzige Lösung.«
Ziel des Kongresses ist ein Neustart des »Friedenslagers« in Israel. Es soll deutlich werden, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung für ein Ende der israelischen Besatzung ist und für eine Zukunft, in der Israelis und Palästinenser*innen in Frieden und gleichberechtigt in der Region leben. Entsprechende Perspektiven sollen wieder auf die politische Tagesordnung in Israel, von der sie unter den rechten bis rechtsextremen israelischen Regierungen der letzten Jahre und insbesondere seit dem 7. Oktober 2023 weitgehend verschwunden sind.
Proteste gegen das brutale Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza gibt es durchaus auch in Israel. Nach dem 7. Oktober unterstützte zunächst ein Großteil der jüdisch-israelischen Gesellschaft unter dem Eindruck des von der Hamas verübten Massakers an Zivilist*innen und des damit verbundenen Traumas den Krieg in Gaza sehr klar. So meldeten sich anfangs deutlich mehr Reservist*innen als benötigt zum Militärdienst. Über die Kriegsdauer hinweg ist aber das Vertrauen von Israelis in ihre Regierung deutlich geringer geworden.
Menschen sollen ermutigt werden, selbst aktiv zu werden.
Besonders anhaltend und sichtbar sind in Israel vor allem die Proteste, die fordern, dass die israelische Regierung alles für die Freilassung der noch in Gaza verbliebenen 56 Geiseln tut. Damit verbunden ist häufig die Forderung nach einem Ende des Kriegs dort. Diejenigen in Israel, die darüber hinausgehen und sich auch für ein Ende der Besatzung, Menschenrechte, Demokratie, ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinenser*innen in der Zukunft engagieren, sind aktuell allerdings eine kleine Minderheit. Aktivist*innen berichten, dass außerhalb ihrer progressiven Blase Gedanken an ein Ende der Besatzung oder eine Zukunft, in der Israelis und Palästinenser*innen in Frieden in der Region leben, als Illusion oder gar Verrat gesehen werden. Rula Daood, palästinensische Ko-Direktorin von Standing Together, erzählt auf der Bühne von einer Mahnwache in Yaffa mit Fotos von in Gaza getöteten Kindern. Ein jüdisch-israelischer Passant kommentierte: »Besser deren Kinder als unsere«. Daood entgegnete, dass es am besten sei, wenn gar keine Kinder im Krieg getötet würden. Reaktion des Passanten: »Einverstanden, aber das wird nicht passieren.«
Deswegen geht es bei der Konferenz auch darum, Hoffnung am Leben zu halten. Menschen sollen ermutigt werden, selbst aktiv zu werden. Dahinter steht die Annahme, dass es in der israelischen Gesellschaft mehr Unterstützung für progressive Positionen gibt, als derzeit sichtbar ist.
Breite Koalition
Organisiert wird der Gipfel von »It’s time«, einer breiten Koalition aus 60 Organisationen. Dazu gehören schon Jahrzehnte lang aktive Organisationen wie Machsom Watch oder Peace Now, aber auch später gegründete wie Standing Together oder Zazim. In ihrem Politikverständnis unterscheiden sich die Organisationen teilweise deutlich voneinander – von Standing Together, die sich als Grassroots-Bewegung sehen, bis hin zur Genfer Initiative, deren Fokus auf internationaler Diplomatie liegt. Viele der beteiligten Organisationen – wie Woman Wage Peace oder Combatants for Peace – sind gemeinsame israelisch-palästinensische Organisationen. Bei manchen beschränkt sich aber die Beteiligung von palästinensischer Seite auf Palästinenser*innen, die israelische Staatsbürger*innen sind oder in Ostjerusalem leben.
Bei der Eröffnungsveranstaltung betreten nacheinander viele Redner*innen die Bühne. Manche sind Vertreter*innen von Organisationen, andere Unterzeichner*innen von offenen Briefen oder Appellen gegen den Krieg. Auch Mitglieder (eher) linker Parteien im israelischen Parlament sprechen, Videobotschaften des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas werden abgespielt.
Die Sprecher*innen sind in ihrer Mehrheit jüdische Israelis und in Israel oder Ostjerusalem lebende Palästinenser*innen. Palästinenser*innen aus dem Westjordanland sind kaum vertreten. Ein Grund dafür ist, dass die israelischen Behörden ihnen derzeit kaum Genehmigungen zur Einreise nach Israel erteilen. Manche palästinensische Sprecher*innen werden deswegen per Video zugeschaltet.
Unter den Teilnehmenden sind jüdische Israelis in der Mehrheit, daneben sind auch Palästinenser*innen und internationale Diplomat*innen vertreten. Kommunikation findet zumeist auf Hebräisch statt; nur einige der Palästinenser*innen wiederholen ihre Statements auch auf Arabisch. Die Teilnehmenden scheinen viele der Sprecher*innen zu kennen und begrüßen manche mit stehenden Ovationen. Die »Szene« der Aktivist*innen ist klein.
Die politischen Zugänge der Sprecher*innen sind sehr unterschiedlich. Mehrere Statements kommen beispielsweise von teils hochrangigen Reservisten der israelischen Armee, die in den letzten Wochen verschiedene öffentliche Appelle an die Regierung gerichtet haben. Sie kritisieren, dass der Krieg in Gaza keinerlei Sicherheitsinteressen Israels mehr diene. Deutlich radikaler ist beispielsweise Alon Lee Green, der israelische Ko-Direktor von Standing Together: Er spricht sich für eine Ende der Besatzung und eine Zweistaatenlösung aus, ruft dazu auf, den Kriegsdienst zu verweigern.
Eine Vertreterin von Israel Schelanu, einer Organisation, die sich vor allem an die russischsprachige Bevölkerung in Israel richtet, berichtet von ihrer Arbeit mit jüdischen Neueinwander*innen aus Russland und der Ukraine. Von ihnen sind eine Viertel Million nach Russlands Angriff auf die Krim nach Israel eingewandert. Sie denkt, dass viele von ihnen bereit sind, Frieden zu unterstützen und sich für Demokratie einzusetzen – auch nach der Erfahrung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Es gebe allerdings wenige Organisationen in Israel, die sich darum bemühten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Einige der Sprecher*innen haben Angehörige verloren – die Israelis am oder nach dem 7. Oktober, Palästinenser*innen bei israelischen Militäroperationen. Andere sind Angehörige von Geiseln. Trotzdem scheint für fast alle Sprecher*innen klar: Jüdische Israelis und Palästinenser*innen leben in der Region und keine Seite wird gehen oder soll gehen müssen.
Sichtbar werden Unterschiede zwischen Generationen von Aktivist*innen. Die israelische Friedensbewegung hatte in den letzten Jahrzehnten einen eher hohen Altersdurchschnitt. Ältere Aktivist*innen haben die Zeit der Osloer Abkommen zwischen Israel und der PLO in den 1990er Jahren erlebt. Damals gab es – bei aller Kritik an den Osloer Abkommen – Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung des Konflikts. Die Trennungsmauer zwischen dem Westjordanland und Israel war noch nicht gebaut. Es gab Räume, wo sich Israelis und Palästinenser*innen als Zivilist*innen – wenn vielleicht auch nur oberflächlich – begegneten. Anders sieht das für jüngere Menschen aus: Eine Vertreterin der Organisation Mechazkim, deren Schwerpunkt Online-Aktivismus ist, sagt: »Ich bin unter der Netanjahu-Regierungen aufgewachsen, inmitten von Aussagen wie ›Es gibt keinen Partner‹ und ›Es gibt keine Alternative‹. Meine Generation ist aufgewachsen zwischen einem Anschlag und noch einem Anschlag und noch einem Krieg. Ich bin 27, und ich war auf zu vielen Begräbnissen.«
Perspektiven nach dem Krieg
Ein Podium widmet sich Ansätzen für eine diplomatische Lösung des Konflikts. Verschiedene israelisch-palästinensische Initiativen – A Land for All, die Genfer Initiative und Phoenix Framework – stellen ihre Visionen vor. Alle beinhalten eine Zweistaatenlösung. Das Phoenix Framework haben vor allem jüngere Menschen auf beiden Seiten entwickelt. Es behandelt neben Themen, die bisher als Kernthemen für ein Friedensabkommen gelten, wie der Status von Jerusalem oder ein Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge, auch andere Themen wie die Klimakrise und den Umgang mit Traumata, denn, wie die palästinensische Vertreterin der Initiative leicht ironisch sagt: »Between the river and the sea, everyone has PTSD.«
Das Podium begegnet damit der Annahme, dass es auf der palästinensischen Seite keinen Partner für Frieden gebe. Diese äußert auch jemand in einem Zwischenruf aus dem Publikum. Ein israelischer Podiumsteilnehmer reagiert darauf recht trocken: Es sei ja auch in Israel nicht wirklich ein Partner für Friedensgespräche erkennbar, und vielleicht sollte sich die israelische Gesellschaft zunächst einmal darum kümmern.
Wird der Kongress einen Neustart des Friedenslagers in Israel erreichen? Gut stehen die Chancen dafür aktuell nicht. Trotzdem sind Räume, die der Stärkung derjenigen dienen, die aktiv sind, ungemein wichtig. Und wie auf einem zweisprachigen Aufkleber von Standing Together steht: »Wo ein Kampf existiert, gibt es Hoffnung.«