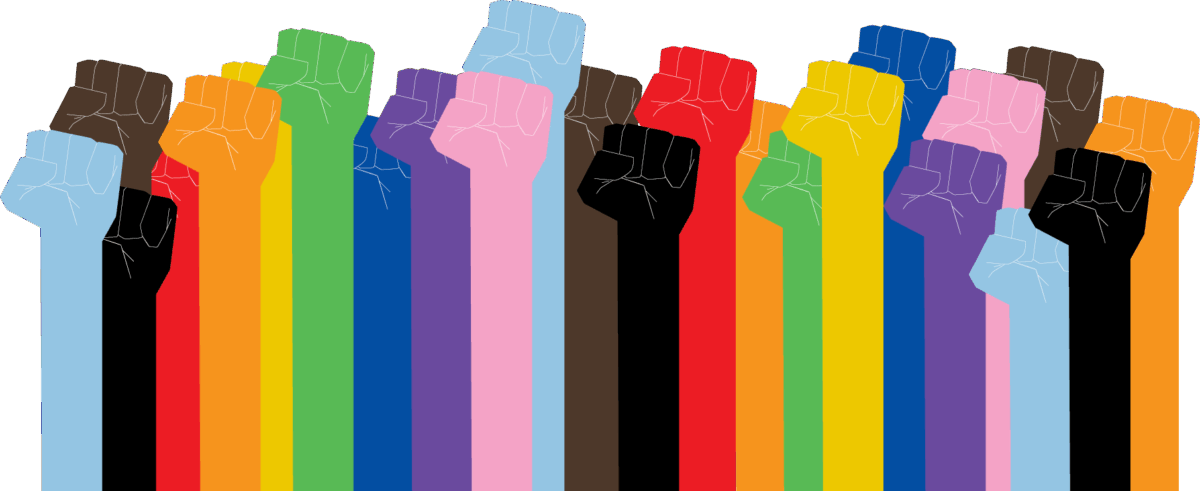»Das Begehren nach anderen Verhältnissen schlummert in uns allen«
Historisch-materialistische und queere Analysen können sich ergänzen, sagt Friederike Beier
Interview: Pajam Masoumi

Queerfeministische und historisch-materialistische Theorien sind widersprüchlich. Oder? Die Politikwissenschaftler*in Friederike Beier hat einen Sammelband zum Thema herausgegeben. Im Gespräch mit ak berichtet sie, was einen materialistischen Queerfeminismus ausmacht, wie er den historischen Materialismus ergänzt und was das für Bewegungen und Klassenkämpfe bedeuten kann.
Steigen wir mal mit einer Art Definition ein: Was ist materialistischer Queerfeminismus?
Friederike Beier: Das Konzept verbindet marxistische Klassenanalyse mit queerfeministischer Kritik an Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität. Es bezieht sich auf den historischen Materialismus von Marx und Engels, der sagt, dass Identität in der Gesellschaft immer mit den Produktions- und Reproduktionsverhältnissen zusammenhängt: einerseits mit der Art und Weise wie die Güter zum Leben produziert werden, andererseits aber auch wie Menschen geboren, erzogen, gepflegt werden.
Klasse ist ein Verhältnis, das sich historisch verändert, je nach Entwicklungsstufe des Kapitalismus. Ähnlich ist es auch mit Geschlecht: Dem historischen Materialismus zufolge muss sich die Kategorie Geschlecht verändern, wenn sich die Klassenverhältnisse ändern. So kann man gut zeigen, dass Geschlecht eine soziale Konstruktion ist, was wiederum anschlussfähig ist für queer-theoretische Überlegungen, nach denen es nicht zwei biologische Geschlechter gibt, sondern in denen Geschlecht ein Spektrum ist.
Ein Beispiel: In der derzeitigen Phase beruht der Kapitalismus auf der Norm von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit, da er die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit braucht, damit Arbeiter*innen geboren und arbeitsfähig werden. Gleichzeitig wird diese Arbeit aber abgewertet und besonders von FLINTA verrichtet. Somit macht sich der Kapitalismus Geschlechterungleichheit zunutze. Die Philosophin Jule Govrin hat dafür den Begriff der differenziellen Ausbeutung geprägt, der zeigt, dass der Kapitalismus spezifisch ausbeutet, je nach Identität und Kategorisierung.

Friederike Beier
ist Herausgeber*in des Sammelbands »Materialistischer Queerfeminismus« sowie der Reihe »Theorien und Kämpfe der sozialen Reproduktion«. Sie beschäftigt sich mit queer-feministischen, materialistischen und dekolonialen Theorien zu Zeit, Geschlecht und Arbeit.
Foto: Anna Gold
Wie hängen Identitätsbildung und Begehren mit den ökonomischen Bedingungen zusammen?
Der Kapitalismus ist davon abhängig, dass Menschen geboren und umsorgt werden, und gleichzeitig sind genau diese Aktivitäten nur begrenzt produktiv. Sorgearbeit ist sehr zeit- und arbeitsintensiv und kann nur begrenzt effizienter gestaltet werden: Man kann Kindern zum Beispiel nicht schneller beibringen, sich die Schuhe zuzubinden
Durch die heteronormative Zweigeschlechtlichkeit wird diese Arbeit als unbezahlt ausgelagert. Insofern stabilisiert sich die Reproduktion im Kapitalismus, aber auch die Reproduktion des Kapitalismus stabilisiert sich durch dieses System der Geschlechtlichkeit. Dafür gibt es die Organisationsform der Familie, in der Eigentum gesichert und über das Erbe weitergegeben wird. Über die Familie werden auch der Kapitalismus und die Klassen- und Geschlechterverhältnisse weitergegeben, in die wir hineingeboren werden.
Der materialistische Queerfeminismus ist emanzipatorisches Wissen, bei dem es darum geht, die Verhältnisse nicht nur zu analysieren, sondern auch zu überwinden.
Dadurch kann es keine freie Liebe geben, weil wir immer schon in Machtverhältnissen eingebunden sind. Viele Studien belegen, dass in Liebe in Zeiten des Kapitalismus auch eine Form von Besitzwahrung steckt, etwa, wenn man die andere Person exklusiv »besitzen« oder sich ökonomisch absichern möchte. Das prägt auch unsere Sexualität: Wenn Menschen das Begehren haben, Verantwortung für Kinder zu tragen, werden sie schneller in heterosexuelle Beziehungsweisen gedrängt, einerseits, um sich zu reproduzieren, andererseits aber auch, um Eigentum abzusichern.
Du hast zu Beginn gesagt, dass sich das Konzept auf den historischen Materialismus bezieht, aber auch an Queerfeminismen anknüpft. Ist der materialistische Queerfeminismus also eine Erweiterung oder grenzen sich die Theorien auch voneinander ab?
Wenn man den historischen Materialismus auf Geschlecht bezieht und umgekehrt, ist der materialistische Queerfeminismus eine wichtige Erweiterung des Konzepts. Das Problem ist, dass Marx und Engels vor allem die Lohnarbeitsverhältnisse untersucht haben, während ein großer Teil der weltweit geleisteten Arbeit aber außerhalb der kapitalistischen Produktion stattfindet: als Subsistenz, also dass Menschen anbauen und produzieren, was sie selbst konsumieren, als informelle Arbeitsverhältnisse, die zum Beispiel noch Teile von Tauschhandel beinhalten, oder als Formen unbezahlter Haus- und Sorgearbeit. Diese Arbeitsverhältnisse werden durch klassische historisch-materialistische Analysen kaum gesehen, was dazu führt, dass der Mechanismus der differenziellen Ausbeutung ebenfalls nicht in den Blick gerät. Das ist aber ein wichtiger Punkt, den auch marxistische Feminist*innen stark gemacht haben.
In deren Analysen wurde jedoch oft die Hetero-Cis-Kleinfamilie reproduziert, weil sie an ihr gezeigt haben, wie die Hausfrau im Fordismus ausgebeutet wird. Was sie aber nicht strukturell mitgedacht haben, war die Lebensrealität von Schwarzen Frauen, Arbeiter*innen oder queeren Beziehungsweisen und Vergeschlechtlichungen jenseits der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit. Deswegen war eine queer-theoretische, aber auch eine intersektionale Erweiterung wichtig.
Und was bedeutet das für die Praxis?
Der materialistische Queerfeminismus ist emanzipatorisches Wissen, bei dem es darum geht, die Verhältnisse nicht nur zu analysieren, sondern auch zu überwinden. Das bedeutet, in verschiedenen Kontexten diese vergessenen Verhältnisse zu thematisieren und zum Beispiel in Arbeitsstreikkontexten zu zeigen, dass, wenn wir nur die Lohnarbeit bestreiken, wir die anderen Arbeitsverhältnisse nicht sehen. Deswegen braucht es z.B. politische Streiks, die es vermögen, unterschiedliche Gruppen – all diese Menschen, die unterschiedlich ausgebeutet werden – in einer gemeinsamen, solidarischen Perspektive zu verbinden und gegen die Zurichtung des Systems zu organisieren.
Andererseits geht es auch darum zu zeigen, dass es nicht reicht, immer nur innerhalb der eigenen Bubble Politik mit Menschen zu machen, die genauso denken wie man selbst, sondern auch strategische Bündnisse einzugehen mit Leuten, die vielleicht nicht die eigene queere Analyse teilen, aber für ein Ende von Ausbeutung kämpfen.
Gibt es dafür Beispiele?
Etwa die FANTIFA-Mobilisierung zu den CSDs in ostdeutschen Kleinstädten. Diese Gruppen hätten sonst vielleicht an anderer Stelle nicht zusammengearbeitet.
Oder die Bewegung Ni una menos in Argentinien, die sich gegen Feminizide richtet. Dort ging es erstmal darum, dass cis Frauen ermordet, verschwinden gelassen und Opfer sexualisierter Gewalt werden. Dann stellte sich heraus, dass diese Gewalt auch trans Menschen betrifft. Gleichzeitig hat die Bewegung Theoriearbeit geleistet und gezeigt, wie physische Gewalt mit der ökonomischen Gewalt und der Verschuldung Argentiniens, aber auch mit der individuellen Verschuldung der Privathaushalte zusammenhängt: Wenn die ökonomischen Bedingungen so schlecht sind und es Haushaltsschulden gibt, dann können Menschen patriarchale Verhältnisse nicht verlassen und sind dazu gezwungen, sich weiter der Gewalt auszusetzen.
Du forschst und lehrst an der Uni. Linke Theorien haben es oft schwer, aus dem akademischen Kontext rauszukommen. Was gäbe es denn für Möglichkeiten, diese Diskussion stärker in die Praxis und die Bewegung zu bringen?
Theorie kann Menschen helfen, ihre eigenen Gefühle, Verkörperungen und ihre soziale Lage zu verstehen. In Bewegungen gibt es immer wieder queere Menschen, die nicht mitgedacht werden und dann aus der Organisierung rausfallen. Insofern braucht es Interventionen in Klassenkonflikte und marxistische Kontexte, in denen man sagt: »Nein, Moment mal, das hat auch was mit Geschlecht zu tun.« Interventionen braucht es aber auch, wenn es in manchen queerfeministischen Kontexten vorrangig um queere Repräsentation geht und das Klassenverhältnis ausgeblendet wird. Queerfeministische Politik ist wichtig, aber sie wird Geschlechter-Ungleichheit und Heteronormativität nicht abschaffen, solange sie nicht die ökonomischen Verhältnisse transformiert. Da brauchen wir ein viel radikaleres Zusammendenken.
Manche Arbeit kann man nicht effizienter gestalten, zum Beispiel Kindern schneller beibringen, sich die Schuhe zuzubinden.
Viele haben Angst beim Thema Geschlecht und wenn es um die Abschaffung der Familie geht: »Oh Gott, jetzt soll mir auch noch mein privater Schutzraum genommen werden!« Ich glaube, da ist es wichtig zu zeigen, was alles zu erreichen ist: Immer mehr Menschen sind erschöpft, weil sie so viel auf einmal handeln müssen, und scheitern immer wieder an den eigenen Ansprüchen. Das muss aber nicht so sein, sondern könnte kollektiv organisiert werden. Wenn wir von einer kapitalistischen Welt wegkommen, die einen Lohnarbeitsfetisch hat, hin zu einer, die stattdessen das umeinander sorgen und die Bedürfnisse der Einzelnen in den Vordergrund stellt, gibt es für alle Menschen etwas zu gewinnen.
Trotzdem wird um das Wie und mit welchen Ansätzen eine hitzige Debatte geführt. Wie hast du das auf deinen Lesungen erlebt?
Die Lesungen waren eine tolle Erfahrung, das habe ich mir vorher nicht träumen lassen. Es gab sowohl ältere marxistische Feminist*innen, als auch jüngere Queerfeminist*innen, die alle in den Texten Anschlusspunkte finden konnten. Ich hatte das Gefühl, viele haben ein Begehren nach gemeinsamer Organisierung – trotz Differenzen.
Besonders in autoritären Zeiten braucht es eine Vorstellung davon, wie alles ganz anders sein kann. Am Ende meines Buches versuche ich deswegen noch einen kleinen Blick in eine Utopie. Bei den Lesungen habe ich gefragt und das Publikum gebeten aufzuschreiben, woran sie merken würden, dass sie in einer sorgezentrierten, geschlechtslosen Gesellschaft aufwachen. Was wäre dann anders?
Und jetzt habe ich einen ganzen Schuhkarton voller wunderschöner Vorstellungen von einer anderen Gesellschaft, die mir sehr viel Hoffnung machen. Denn in ihnen steckt das Begehren, anders zu leben, zu lieben, zu arbeiten, und ich glaube, dieses Begehren nach anderen Verhältnissen schlummert in uns allen.