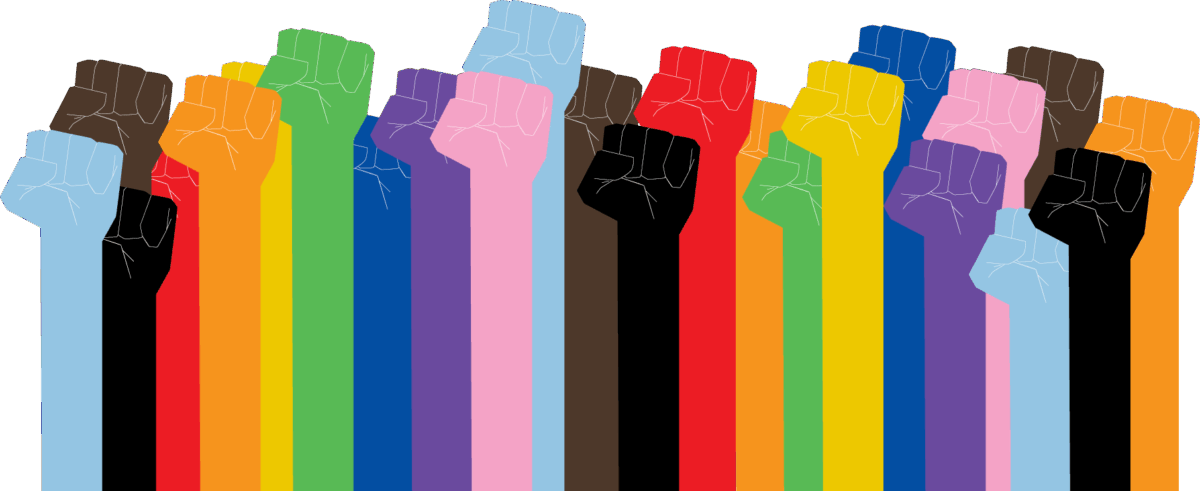Orte radikaler Hoffnung
CSDs in kleinen Städten sind mehr als bunte Feste: Im Schatten rechter Mobilisierung entwickeln sich neue Formen kollektiver Solidarität
Von Rebecca Jakob

Es zeichnet sich bereits ab, dass auch im Sommer 2025 queere Bewegungen in Ostdeutschland verstärkt in den Fokus rechter Mobilisierung geraten. CSDs in kleinen Städten und ländlichen Regionen sind Zielscheiben einer zunehmend koordinierten rechten Mobilisierung. Die Gewalt richtet sich dabei nicht nur gegen einzelne Veranstaltungen, sondern zielt auf die allgemeine Sichtbarkeit queeren Lebens. Einschüchterungskampagnen in sozialen Medien, physische Präsenz militanter Neonazis, gezielte Störaktionen und strukturelle Schikanen schaffen ein Klima ständiger Bedrohung.
Dabei ist es nicht nur die Kontinuität rechter Gewalt, die erschüttert, sondern auch die neue strategische Qualität der Mobilisierungen. Diese Angriffe stehen exemplarisch für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, in der queere, feministische und migrantische Lebensformen zur Projektionsfläche einer autoritären Rechten werden. Es geht dabei nicht um Protest, sondern um Deutungshoheit und um die Macht auf der Straße. Sichtbarkeit ist hier kein symbolischer Luxus, sondern ein prekär erkämpftes Gut. Sie muss unter Bedingungen hergestellt werden, die von ökonomischer Unsicherheit, institutioneller Abwesenheit und einer ständigen Bedrohung durch rechte Gewalt geprägt sind.
Die Notwendigkeit sich gegenseitig zu schützen, erzeugt eine politische Verbundenheit.
Die Praxis der CSD-Organisation in der ostdeutschen Provinz ist damit nicht nur ein kultureller oder identitätspolitischer Akt, sondern eine Form kollektiver Politik von unten, getragen von Care-Arbeit, unbezahltem Engagement und dem Anspruch auf Selbstbestimmung inmitten struktureller Marginalisierung.
Mehr als Reaktion
Gleichzeitig entstehen genau hier neue Formen der Solidarität. Und diese Solidarität ist mehr als ein symbolisches Band. Sie ist konkret, praktisch, politisch. Viele CSDs im ländlichen Raum sind längst mehr als reine Paraden. Sie sind Plattformen widerständiger Praxis, an denen sich queere Selbstbehauptung, feministische Allianzen und antifaschistische Schutzstrukturen begegnen. Es ist kein Zufall, dass die tatsächliche Sicherheit dieser Veranstaltungen häufig nicht durch staatliche Institutionen gewährleistet wird. Vielmehr sind es linke und antifaschistische Gruppen, die für Schutz sorgen, Awarenesskonzepte mitentwickeln, Bedrohungslagen analysieren und praktische Solidarität leisten.
Diese kollektiven Praktiken sind nicht bloß Reaktion auf eine Bedrohung, sondern Ausdruck einer widerständigen politischen Subjektivität. Was in diesen Kontexten sichtbar wird, ist auch ein tieferes politisches Verhältnis: Es entsteht eine solidarische Infrastruktur, die sich nicht auf staatliche Anerkennung verlässt, sondern aus der Erfahrung kollektiver Verletzlichkeit heraus handelt. Die kollektive Arbeit zeigt, was möglich ist, wenn marginalisierte Gruppen nicht nur um Anerkennung bitten, sondern solidarische Räume selbst schaffen. Die queer-feministischen CSDs sind hier keine importierten Großstadtformate, sondern lokal verankerte Versuche, eine emanzipatorische Praxis unter widrigsten Bedingungen zu etablieren. Die Erfahrung geteilter Verletzbarkeit, die Notwendigkeit, sich gegenseitig zu schützen, erzeugt eine politische Verbundenheit, die über reine Zweckbündnisse hinausgeht.
Identität und Klassenfrage
Queere Sichtbarkeit im ländlichen Raum ist somit nicht nur eine Frage der Repräsentation, sondern eng mit sozialen Verhältnissen verknüpft. Wer sich ein öffentliches Coming-Out leisten kann, wer die emotionale und organisatorische Arbeit rund um CSDs trägt, wer sich zurückziehen kann, wenn es gefährlich wird: all das ist auch eine Klassenfrage. Viele der Aktiven leben prekär, sind in Care-Berufen tätig oder in Regionen aufgewachsen, in denen queeres Leben kaum öffentliche Resonanz erfährt. Ihre Organisierung ist nicht glamourös, sondern kräftezehrend und notwendig. Und gerade deshalb sind die CSDs im ländlichen Raum Orte radikaler Hoffnungen.
Vor diesem Hintergrund müssen sich auch linke Strukturen fragen lassen, welches Verhältnis sie zum ländlichen Raum entwickeln. Allzu oft wird er nur als Krisenraum gedacht, als Ort besonderer Rückständigkeit oder rechter Dominanz. Diese Perspektive verkennt das emanzipatorische Potenzial, das dort entsteht, wo sich Menschen im Angesicht größter Widerstände zusammentun. Die deutsche Linke muss den ländlichen Raum nicht nur als Ort der Bedrohung begreifen, sondern als Terrain emanzipatorischer Kämpfe. Und sie muss bereit sein, Ressourcen zu teilen: Technik, Übersetzungen, Rechtsberatung, Präsenz, mediale Reichweite. Nicht, um zu »helfen«, sondern, um Teil eines kollektiven Projekts zu sein, das sich gegen die Normalisierung rechter Gewalt ebenso wehrt wie gegen die politische Gleichgültigkeit einer vermeintlich liberalen Mitte.
Das Netzwerk »Wir sind das bunte Hinterland« formuliert diese Perspektive explizit: Es geht nicht nur darum, Inseln des Fortschritts in einem vermeintlich rückständigen Umfeld zu errichten, sondern darum, solidarische Infrastrukturen zu schaffen, die aus den Kämpfen selbst hervorgehen. Verbundenheit nicht im Sinne ideologischer Homogenität, sondern als die Praxis, dass man sich aufeinander verlassen können muss, gerade dann, wenn niemand anderes kommt. Diese Form der politischen Verbundenheit ist nicht weich oder harmonisierend, sondern geprägt von Differenz und Streit und doch getragen von einer Ethik der Fürsorge.
In dieser solidarischen Praxis liegt ein Potenzial, das über die einzelnen Veranstaltungen hinausweist. Sie sind nicht nur Feier, sondern Gegenmacht. Nicht nur Widerstand, sondern Entwurf. Sie bringen feministische, antifaschistische, migrantische und klassenpolitische Perspektiven zusammen und bemühen sich dabei um eine intersektionale Herangehensweise. Nicht im Modus akademischer Theorie, sondern als gelebte Praxis kollektiver Sorge und radikaler Hoffnung. Der CSD in der ostdeutschen Kleinstadt ist damit weit mehr als ein Fest der Vielfalt. Er ist ein politischer Ernstfall und zugleich ein Versprechen, dass auch unter widrigsten Bedingungen eine andere Gesellschaft sichtbar werden kann. Eine, die weiß, dass Solidarität kein Gefühl ist, sondern eine Praxis.