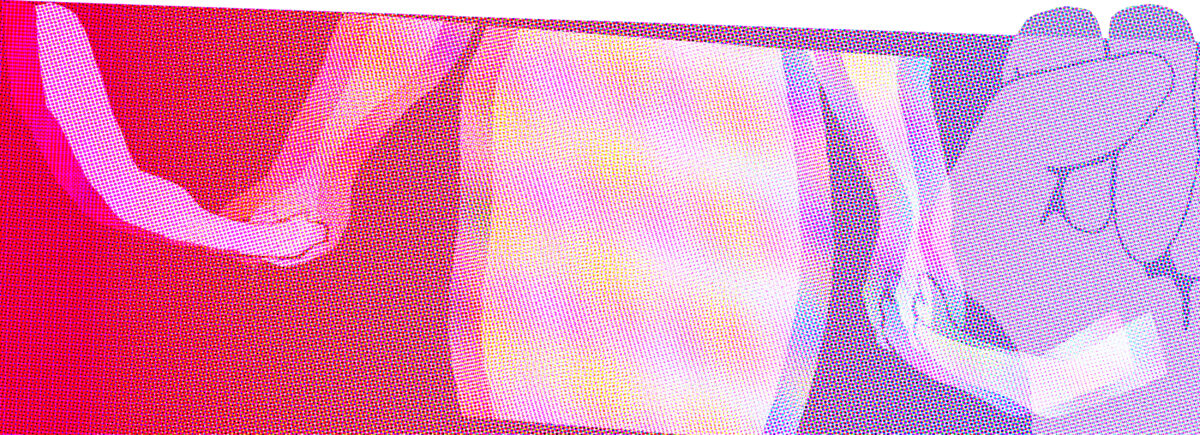Über Verbindlichkeit, Hedonismus und verbindlichen Hedonismus
Von ViolA Butzlaff

Hintertüren – Alex
(Auszug)
Weißt du noch, wie wir anders warn?
Wie wir träumten leidenschaftlich radikal?
Das war ne geile Zeit, damals vor Jahrn.
Naja, is spät geworden, ich glaub ich muss dann mal.
Ey, jetzt lass mich doch mal mit deinem Kind in Frieden,
is doch dein Körper, du hattest doch die Wahl.
Was weiß ich, mit wem du’s sonst noch getrieben
hast, bis die Vaterschaft bewiesen ist, is mir das Balg egal.
Du, das mit dem Kind hier im Haus, das wird nicht gehen,
tut mir leid, aber das Plenum war dagegen.
Da waren Bedürfnisse, das musst du doch verstehen,
Aber wir helfen gern beim Umzug – kein Problem!
Ja, ich find auch, die is voll bürgerlich geworden.
Seit das Kind da ist, kommt die kaum noch hier ins Haus.
Das Kinderkriegen hat ja so viele schon verdorben,
denn dann woll’n die immer auf ne Kleinfamilie raus.
Und der Wind rüttelt an den Fensterläden,
die Kerzen hat er längst schon ausgeblasen,
ja er zieht, während wir im Finstern reden,
denn wir haben die Hintertüren aufgelassen.
Ich hab’ ja schon lange davon geträumt, dass ich mal die Inspiration für jemanden bin, einen Song zu schreiben. Doch in meiner Fantasie trällerte eher ein sehr verliebter Mensch unter meinem Balkon ein Lied, in der mein Name den Refrain bildet, und zwar nur mein Name. Als der Patenonkel meines Kindes mir sehr vorsichtig, aus der Befürchtung heraus, dass Menschen erkennen könnten, dass es Parallelen zu meiner Geschichte und dem Lied gibt, den Auszug aus dem oben aufgeführten Lied vorspielte, fühlte es sich doch irgendwie anders an.
Klar, auf der einen Seite war ich berührt, dass er einige Inhalte aus meinem Leben und dem meines Kindes in einem Lied verarbeitet. Ich war aber auch traurig und wütend darüber, was mir passiert ist. Die Geschehnisse aus einem anderen Mund zu hören, vorgetragen auf einer Bühne, gab mir selbst einen anderen Zugang zu all dem.
Doch erst mal zum Anfang, denn eigentlich sollte mein Text so losgehen: Nichts hat mein Leben so verändert wie die Geburt meines Kindes. Das sagen sicher die meisten Eltern. Ich meine damit aber weniger den Schlafentzug, die plötzliche allgegenwärtige Verantwortung oder die schönen Momente voller Leichtigkeit, die ein Kind mitbringt. Ich meine vor allem den Verlust von Freund*innenschaften, die Isolation und den fehlenden Anschluss an die linke (queerfeministische) Szene.
Die Gründe für den Verlust der Freund*innenschaften sind komplex und verschiedener Intensität. Selbst Jahre nachdem das alles passiert ist, fällt es mir schwer, darüber zu schreiben, weil die Trauer und die Enttäuschung so tief sitzen. Ich hab’ mit der Geburt meines Kindes circa 2/3 meiner Freund*innenschaften eingebüßt. In den ersten Wochen nach der Geburt raubten mir die Gedanken an die Freund*innenschaften gefühlt mehr Schlaf als das wiederholte nächtliche Stillen meines Babys.
Einige Menschen standen mir sehr nahe, sodass der Bruch sehr schmerzte. Es waren insgesamt vier meiner engsten Freund*innen. Eine von ihnen begleitete mich durch die Schwangerschaft und war auch bei der Geburt dabei. Kurz nachdem das Kind da war, brach sie den Kontakt ab. Ich kann nur spekulieren, was ihre Gründe sind. Vermutlich war das passive Erleben dieser Geburt eine unüberwindbare Belastung. Die Geburt verlief nicht planmäßig und war … hm … wie beschreibe ich denn adäquat, wie diese Geburt war … ich glaube, »schrecklich« ist passend. Schrecklich trifft’s, und in Psychosprech: traumatisch. Ich hatte noch ein Jahr später Flashbacks von einzelnen Momentaufnahmen. Das war auch für die Begleiterinnen zu viel. Zumindest war diese Freund*innenschaft dann vorbei.
Eine andere mir sehr nahe Person verabschiedete sich in den Monaten darauf. Wenn ich ehrlich bin, hab’ ich den Verlust nie überwunden. Es war ein Konglomerat aus Überforderung, Eifersucht, Prioritäten setzen (zu meinen Ungunsten) und vielleicht seinem Umgang mit Konfliktsituationen.
Klar, fehlende Freund*innenschaften führen neben der Trauer um den Verlust auch zu Isolation. Um nicht isoliert zu sein, hatte ich mir von Anfang an vorgenommen, nicht allein mit dem Kind zu wohnen. Ich wollte das Kind in meiner damaligen WG bekommen und habe versucht, das dort früh zu thematisieren, also haben wir das besprochen, als ich im vierten Monat schwanger war. Es schien, als sei alles abgemacht, doch als ich dann im achten Monat war, löste sich die WG auf, und ich musste mir schnell etwas zum Wohnen suchen. Ich bin allein in eine Wohnung gezogen. Vorübergehend, so dachte ich. Bis ich eine gute kollektive Alternative gefunden hab’. Das hat jedoch nicht geklappt, weil viele WGs und Projekte keine Lust auf ein Kind hatten oder aber die nötige Infrastruktur fehlte, die es braucht, um mit einem Kind zu leben. So haben Kind und ich zwei Jahre nach einer neuen kollektiveren Wohnform gesucht. Vergeblich. Leider.
Schwierige Voraussetzungen, ohne mit Menschen zu wohnen und mit vielen nicht mehr befreundet sein zu können, um trotzdem an die Szene angebunden zu bleiben. Was bleibt noch? Zur KüFa (Küche für Alle, früher Vokü/Volxküche) rennen mit Kind? Gern, aber wenn das Essen erst um 20 Uhr fertig ist und da doch eigentlich das Kind schon im Bett sein muss … schwierig. In Gruppen aktiv sein. Hab’s versucht, aber ohne Kinderbetreuung und ohne dass die Gruppe sich mit auf das Kind bezieht oder zumindest die Existenz berücksichtigt, ist auch das schwer.
Unterm Strich hab’ ich gemerkt, dass das Kind oft als eine Privatangelegenheit angesehen wird. Das Private ist hier nicht politisch oder nur selten. Kinder stören, sind laut und vor allem in der queerfeministischen Szene oftmals nicht willkommen. Die Gründe dafür (wie ich sie mir vorstelle) kann ich zum Teil sogar nachvollziehen. So unterliegen die meisten weiblich Sozialisierten einem gesellschaftlichen Reproduktionsdruck, von dem es sich erst mal loszumachen gilt. Da bleibt das Verständnis dafür, dass sich manche doch für Kinder entscheiden, möglicherweise auf der Strecke. Auch ist es für viele ein Lebensthema, auf die eigenen Grenzen zu achten und etwas hedonistischer zu leben. Sich für ein Kind verantwortlich zu fühlen, kann dieser Entwicklung schon im Weg stehen und fordert Verbindlichkeit. Vielleicht entscheiden sich viele anstatt für Verantwortung für das Streben nach ihrer individuellen hedonistischen Erfüllung? Am Ende wird so der Hedonismus verbindlich. Immerhin erfährt dann irgendwas Verbindlichkeit.
Letztlich haben viele, die nicht mit Kindern leben oder einen engen Bezug zu ihnen haben, auch einfach gar keine Vorstellung davon, was Kinder brauchen und dass Unterstützung für die Verantwortlichen wichtig sein kann. Die Solidarität, die in linkspolitischen Zusammenhängen oft hochgehalten wird, vermisse ich hier sehr. Doch bin ich mir gar nicht sicher, ob diese Solidarität Menschen mit Kindern überhaupt einschließt? Gilt ja schon als Schritt ins Bürgerliche, wenn sich Menschen reproduzieren. Und was ist verpönter als das Bürgerliche?
Auch auf der queerfeministischen Agenda vermisse ich das Thema oftmals. Nun könnte ich es ja einbringen und nicht nur »Jammertexte« schreiben. Aber im alleinerziehenden Alltag geht’s grad mehr um essenzielle Themen und Zwänge (Schlafen, Arbeit, Essen, Krankheit, Betreuung, Geld, Geld, Geld, zu wenig Geld), und es bleibt wenig Kraft, Forderungen zu stellen. Und vielleicht bin ich auch im Prozess, »sich selbst wichtig zu nehmen«, noch nicht an dem Punkt, selbstbewusst nach außen um Hilfe zu bitten? Denn wenn ich darüber schreibe, merke ich, wie ich an mir selbst zweifle. Wie ich denke: Wo ist mein Anteil an der Isolation? Wieso schaffe ich das denn alleine nicht? Das haben doch schon andere geschafft. Oder auch: Sicher gibt es gute Gründe, warum ich alleinerziehend bin. Vielleicht ist es nicht möglich, mit mir zu leben, zu arbeiten, sich zu organisieren, befreundet zu sein?
Und schon befinde ich mich mitten in einer Selbstkrise, geschaffen in einer misogynen Gesellschaft, die weiblich gelesene Menschen kleinhält, damit sie ihre Fehler vehement bei sich selbst suchen, anstatt die Gesellschaft, das System oder manchmal auch einzelne Personen zu hinterfragen und zu kritisieren. Genau diesen Selbstzweifel haben viele weiblich sozialisierte Menschen ihr Leben lang gefressen. »Alles ist meine Schuld« und »Es steht mir nicht zu, diesen Zustand zu kritisieren«. Dabei ist es ein wichtiges feministisches Anliegen, Teilhabe an politischen Zusammenhängen zu fordern! Diskriminierung von Menschen mit Kindern (insbesondere, wenn sie alleinerziehend sind) zu thematisieren, ist wichtig. Den so abgefeierten Hedonismus ab und zu in die Schranken zu weisen, weil es an dem Punkt, wo mensch sich um andere Menschen kümmert bzw. kümmern muss (Kinder, Menschen, die behindert werden, alte oder sogenannte kranke Menschen), nicht mehr funktioniert. Wie würden Kinder denn überhaupt überleben, wenn keine*r über die eigenen Grenzen ginge? Ein Baby ist rund um die Uhr auf Pflege, Zuneigung, Aufmerksamkeit etc. angewiesen, einem Baby hilft die Verbindlichkeit zum Hedonismus kaum …
Doch wer genau soll über diese Grenzen gehen? Da schreien sicher alle: Ja wohl die Eltern! Eine Aussage, die diskutierbar ist. In meinem Fall war es zumindest wie folgt: Der Vater will nicht. Er hat das Kind bis jetzt nicht sehen wollen. In der Schwangerschaft war er sporadisch noch am Start, aber kurz vor der Geburt entschied er sich anders, und dann war alles wie in einer Soap. Er stritt ab, der Vater zu sein, wollte das Kind nicht sehen, begann, mich noch im Wochenbett zu beleidigen … Es gab circa ein Jahr später einen Vaterschaftstest, der natürlich bestätigte, dass er der Vater ist, und dann erkannte er die Vaterschaft an. Auf dem Papier. Kontakt zum Kind wollte er noch immer nicht. Hab’s akzeptiert mittlerweile. Unterhalt zahlt er natürlich nicht. Gut, dann eben nicht. Das funktioniert in dieser Gesellschaft ziemlich gut, dass sich Väter rausnehmen und sich nicht kümmern müssen. Bleibt die Mutter! Ja, die geht über Grenzen, sodass sie beispielsweise im Winter vier Monate am Stück krank ist und nicht mehr gesund zu werden scheint. Sie hat keine Kraft mehr.
Eine. Person. ist. zu. wenig.
Und nun müsste der Absatz kommen, wo die Lösung beschrieben wird oder mindestens noch ein »Happy End« folgt … leider bleibt der aus.