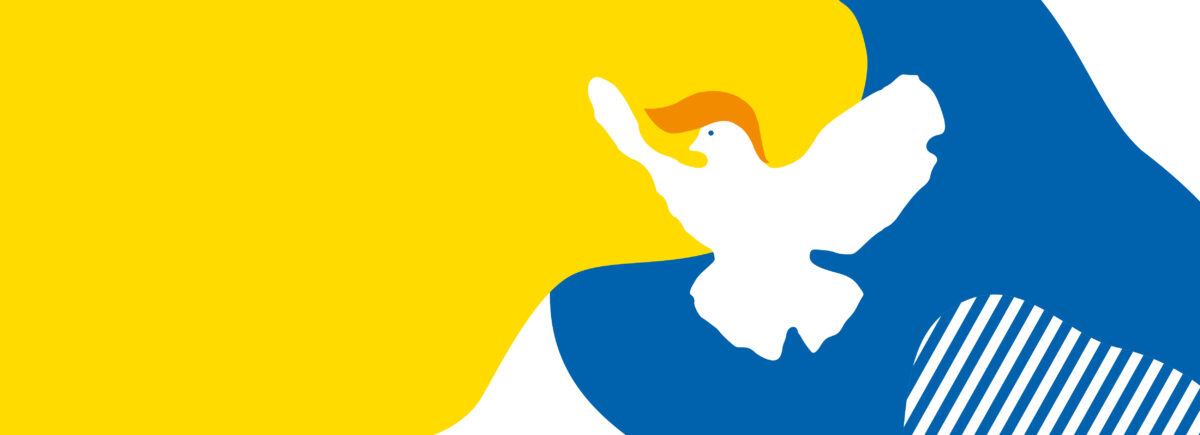Medikamente ins Kriegsgebiet
Die Wuppertaler Initiative Cars of Hope versorgte in der Ukraine Menschen mit lebensnotwendigen Gütern
Von Sebastian Bähr

Die gesellschaftliche Linke in Deutschland hat in den letzten Jahren viel über den Krieg in der Ukraine diskutiert. Einige wenige Projekte zielten auch auf konkrete Hilfe für die Betroffenen ab. Eine Initiative ist die Wuppertaler Gruppe Cars of Hope, die aus fünf Aktiven besteht. Sie sammelt Spenden und unterstützte damit direkt die Menschen im Kriegsgebiet. Die Organisation Help War.Victims aus Kiew half ihnen dabei, das Material an die Zielorte in Frontnähe zu bringen. Die Berliner Organisation Radical Aid Force und das Netzwerk Solidarity Collectives sind Beispiele für ähnliche Projekte.
Der 59-jährige Aktivist René Schuijlenburg engagiert sich bei Cars of Hope. Im Jahr 2022, nach der Eskalation des Krieges, begann die Zusammenarbeit mit Aktivist*innen in der Ukraine, erinnert er sich. »Der Kontakt zu den Menschen war schon da, wir haben uns dann kurzgeschlossen: Was wird gebraucht, was können wir tun?« Man erstellte Listen, die online aktualisiert wurden. Es ging vor allem um Medikamente und medizinisches Material, Lebensmittel, Batterien und Generatoren. Vieles davon wurde in Deutschland gespendet, teilweise gab es auch Unterstützung von Kliniken und Apotheken. Wenn genug Material vorhanden war, wurde ein Transport organisiert.
Im Oktober 2022 war das Team im Osten des Landes im Einsatz, wo die Not am größten war. »Hier wurden weder Apotheken noch Supermärkte beliefert« , sagt Schuijlenburg. Eine 70-jährige Frau, die dort lebte, habe ihm gesagt, dass sie nicht mehr fliehen werde, um sich woanders ein neues Leben aufzubauen. »Jeder Mensch hat das Recht auf die Entscheidung, ob er oder sie geht oder nicht«, so der Aktivist. »Aber wenn die Leute bleiben und abgeschnitten sind, braucht es selbstorganisierte Strukturen, die helfen – das ist für mich Solidarität.«
Unter Beschuss
Der Kontakt zu den ukrainischen Partner*innen wurde im Laufe der Einsätze immer enger. »Nachdem wir das erste Mal zusammen an der Front waren, hatten wir Vertrauen zueinander gefasst«, sagt Schuijlenburg. »Wir gerieten unter Beschuss, konnten aber genau so reagieren, wie wir es vorher gemeinsam besprochen und geübt hatten.« Danach habe man gewusst, dass man »aufeinander bauen kann«. Probleme mit den ukrainischen Behörden habe es unterdessen kaum gegeben, nur Geduld sei wichtig gewesen. Der Grenzübertritt habe mal zwei Stunden gedauert, mal 30. Außerdem gab es immer wieder Straßensperren, an denen die Papiere kontrolliert wurden. »In solchen Situationen versucht man, sachlich und ruhig zu antworten, damit es schnell geht« , sagt Schuijlenburg. »Es geht darum, die Menschen vor Ort zu unterstützen – politisch auf den Tisch hauen kann man woanders.«
Bis April 2023 fanden insgesamt zehn Fahrten der Cars of Hope statt. Danach konnte krankheitsbedingt keine mehr durchgeführt werden. Einmal brachten die Aktivist*innen noch Material in ein Lagerhaus nach Polen an der Grenze, von wo aus es weitertransportiert wurde. Aber der Kontakt zu den Partner*innen wurde gehalten. »Inzwischen kommen weniger Spenden aus ganz Europa«, sagt Schuijlenburg. Zum Teil wohl, weil der Krieg aus den Schlagzeilen verschwunden ist.
Es geht darum, die Menschen vor Ort zu unterstützen – politisch auf den Tisch hauen kann man woanders.
»Die vielen Diskussionen hier machen es aber auch nicht einfacher«, so Schuijlenburg weiter. »Es gibt einfach Menschen in der Ukraine, die Angst haben, dass sie verfolgt werden, wenn Russland dort an die Macht kommt« – es sei wichtig, dass das nicht passiere. Damit sei aber weder eine Hoffnung in den ukrainischen Staat, noch eine Unterstützung der Nato verbunden. »Ich dachte, man müsse nicht darüber diskutieren, dass Putin und die Nato beide Scheiße sind, aber da habe ich mich offensichtlich geirrt.« Um seiner eigenen Gesundheit willen meide er inzwischen manche Diskussion. Nicht zuletzt habe sich auch die Stimmung vor Ort geändert. »Die Leute in der Ukraine sagen uns, dass sie müde sind, zum Teil auch deprimiert, weil sich nichts ändert.« Sie machten trotzdem weiter, aber »mental wird es für sie schwieriger«. Männer müssten außerdem damit rechnen, jederzeit zum Militär eingezogen zu werden, wenn sie ein bestimmtes Alter haben. »Das läuft richtig brutal ab.«
Die Aktivist*innen von Cars of Hope müssen derweil selbst einen Umgang mit bestimmten Erfahrungen finden. Ukrainische Genoss*innen sind ums Leben gekommen, da fühle man sich ohnmächtig, sagt Schuijlenburg. Die Gruppe wurde auch selbst mit Mörsern beschossen. »Wir hatten den Vorteil, dass wir uns gut kannten und so miteinander reden konnten, um das zu verarbeiten. Aber mit der Zeit kamen wir auch an unsere psychische Belastungsgrenze.« Die müsse man auch einhalten – wenn man »das Konto überzieht«, funktioniere man nicht mehr. »Ich war vielleicht vier, fünf Tage in der Ukraine, aber dann zu Hause erst einmal zwei Wochen wie leer.« Er möchte gar nicht daran denken, wie es ist, dauerhaft in einer solchen Gefahrensituation zu leben.
Krisenerprobt
Was Cars of Hope bei der Arbeit in der Ukraine half: Das Team hatte bereits Vorerfahrungen in Krisenregionen gesammelt. Auf der Balkanroute hatten sie in den 2010er Jahren Geflüchtete unterstützt. Sie bauten Unterkünfte auf, verteilten Lebensmittel und Hygieneartikel und versorgten Verletzte. »Wir haben hier gelernt, wie man unter Druck arbeitet, wo unsere Stärken und Schwächen liegen und wie man Logistikketten aufbaut.« Auch mit den Sicherheitsbehörden musste man sich auseinandersetzen. »Es gab Situationen, in denen wir nicht willkommen waren«, sagt Schuijlenburg. Der Aktivist hatte auch schon während des Kosovo-Krieges bei der Evakuierung von Menschen geholfen und war während des Bürgerkriegs in Guatemala vor Ort.
Mit Blick auf die Zukunft ist Schuijlenburg pessimistisch. Was passiert, wenn die Faschisierung weiter voranschreitet? Der Konflikt zwischen den westlichen Staaten und China weiter eskaliert? Es sei möglich, dass perspektivisch Versorgungsstrukturen zumindest zeitweise zusammenbrechen. Mit solchen Szenarien und den damit verbundenen Fragen müsse man sich auseinandersetzen. »Wie viele chronisch kranke Menschen leben zum Beispiel in meinem Stadtteil? Welche lebensnotwendigen Produktionen wurden bereits ausgelagert? Mit wem habe ich Kontakt? Wie kann ich Leid lindern, wenn Versorgungsketten nicht mehr funktionieren? Wie bewege ich mich in einem militarisierten Gebiet? Wie kann ich behördliche Grenzen ausreizen, um meine Ziele zu verwirklichen?« Möglichst viele Menschen sollten über dieses Wissen verfügen, um im Ernstfall handeln zu können. Auch für Schuijlenburg war dieser Erfahrungsschatz eine Motivation, in der Ukraine aktiv zu werden. »All diese Themen könnten eines Tages gar nicht mehr so weit weg sein, wie wir jetzt vielleicht denken.«