Weder antiautoritär noch leninistisch
Was Hans-Jürgen Krahls Auseinandersetzung mit der proletarischen Wende nach 1968 zur neuen Parteidiskussion von Teilen der linken Szene beitragen kann
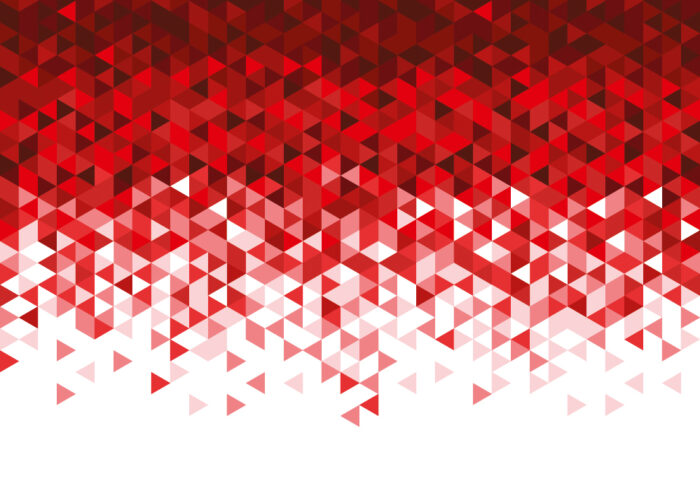
Seit einigen Jahren gibt es eine Revitalisierung der Forderung nach einer neuen kommunistischen Partei. Dieser Neoleninismus geht oft einher mit einer »materialistischen« Kritik der Identitätspolitik: Die Identitätspolitik blende mit ihrem Fokus auf individuelle Probleme den Klassenantagonismus aus und leiste durch ihr Bündnis mit der neoliberalen Ideologie dem Klassenkampf von oben Vorschub. Man könne Identitätsfragen nicht auf eine Ebene mit den »wirklichen« Problemen stellen. Hier reicht der von Sahra Wagenknecht entwickelte Diskurs, auch wenn man sich sonst von ihm abgrenzt, bis in die radikale Linke hinein.
Nach und nach haben sich verschiedene Projekte zu neoleninistischen weiterentwickelt, wie Aurora in Frankfurt a.M. oder das Lower Class Mag, oder in ihnen neoleninistische Fraktionen gebildet, wie in der translib in Leipzig. Teilweise wurden auch neue Projekte gegründet, wie der Bund der Kommunist:innen (BdK) in Berlin. Augenfällig ist, dass viele dieser Gruppen selbst aus dem antiautoritären Milieu und in Auseinandersetzung mit dessen Problemen entstanden sind.
Über organisierte Projekte hinaus ist in Teilen der Szene (zum Beispiel in Freiburg, Bremen, Leipzig) auch ein verändertes kulturelles Klima spürbar: Der Ton wird entschlossener, der Umgang instrumenteller, der Habitus disziplinierter. Man bricht mit dem linksradikalen Hedonismus, nimmt keine Drogen mehr, posiert mit wehenden roten Fahnen auf der Demo, inszeniert eine zupackende Männlichkeit und einen antihedonistischen, »proletarischen« Lifestyle, der wohl auch eine kulturelle Reaktion auf die »Lifestyle-Linke« darstellt.
Klassenbewusste Kommunist*innen
Der Neoleninismus wirft der linksradikalen Szene vor, den Kontakt mit dem Proletariat verloren und mit der tief verinnerlichten Organisationsskepsis nichts erreicht zu haben. Anders als sie arbeiten die neoleninistischen Gruppen an einer Organisierung der Basis, derzeit meist in den Stadtteilen.
Denn für die Arbeiter*innenklasse sei es, aufgrund ihrer prekären Lebenslage, schwierig bis unmöglich, spontan zu kommunistischen Standpunkten und einer kämpferischen Organisierung zu finden. Es brauche dafür klassenbewusste Kommunist*innen, eine Avantgarde. Dem programmatischen Text »Was tun in Zeiten der Schwäche« auf dem Blog Communaut zufolge hätte man bei den Bewegungen der letzten Jahrzehnte wie etwa den Gelbwesten gesehen, wie begrenzt spontane Aufstände des Proletariats seien: Es gebe dann zwar einen kurzen Aufbruch, schnell aber würden reformistische Propagandist*innen tonangebend, die Bewegung falle auf faule Kompromissangebote der Herrschenden herein und verfüge nicht über die organisatorische Festigkeit, um dem Repressionsapparat Paroli zu bieten.
Der Ton wird entschlossener, der Umgang instrumenteller, der Habitus disziplinierter. Man bricht mit dem linksradikalen Hedonismus, nimmt keine Drogen mehr, posiert mit wehenden roten Fahnen.
Die Anti-Partei-Linie der antiautoritären Szene sei daher ein eklatantes Problem, denn bei den Gelbwesten etc. habe das Proletariat es nicht geschafft, eine kollektive Identität auszubilden und zu einer selbständig handelnden Kraft zu werden. Dies werde nur gelingen, wenn eine organisierte Kraft gegen die reformistischen Tendenzen kämpfe und auf solide Strukturen hinarbeite: Nur mit einer kommunistischen Partei könne eine »proletarische Hegemonie« innerhalb der Arbeiter*innenklasse erlangt werden.
Diese Argumentation entspricht fast genau Lenins »Was tun?« von 1902. Lenin attackierte darin die sogenannten Ökonomisten, die für die Spontaneität der Massen und gegen die Führung durch die Partei eintraten, und warf ihnen, die selbst Intellektuelle, keine Arbeiter*innen waren, eine »Anbetung der Spontaneität« vor. Von selbst fänden die Arbeiter*innen aber nur zum Kampf für Reformen, nicht zu einem revolutionären Klassenbewusstsein: »Die spontane Entwicklung der Arbeiterbewegung führt eben zu ihrer Unterordnung unter die bürgerliche Ideologie«, so Lenin. Es brauche daher eine festgefügte politische Organisation mit der richtigen marxistischen Theorie, eine »zentralisierte Kampforganisation«, die die »sozialdemokratische« (heute: kommunistische) Politik konsequent durchführt.
Das Proletariat soll zwar zu einer autonomen Kraft werden und ein echtes »proletarisches« Klassenbewusstsein ausbilden. Das gelinge aber nur, wenn die Partei die Führung des Proletariats übernimmt. Es gehe nur, wenn seine Autonomie außer Kraft gesetzt wird. Nach erfolgreicher Oktoberrevolution ist das die Diktatur des Proletariats, also eine Diktatur über das Proletariat mit der Fassade seiner Autonomie.
Der, diese Gedanken aufgreifende, Neoleninismus reagiert auf die (echte) Schwäche der radikalen Linken und versucht, einen Ausweg zu zeigen. Allerdings hatte das bereits die Organisations- und Strategiedebatte der vorangegangenen Jahre versucht. Begleitet von Strategiepapieren wie den elf Thesen »Für eine grundlegende Neuausrichtung linksradikaler Politik« (2015) und Kongressen wie dem »Selber machen«-Kongress (2017) waren etliche Basisinitiativen wie Wilhelmsburg Solidarisch und Organisationsprozesse wie der »Kongress der Kommunen« gegründet worden. Insgesamt kam es zu einem Bruch mit der subkulturellen Szene und einem deutlichen Richtungsschwenk der antiautoritären Bewegung.
Diese Organisationsdebatte muss man mittlerweile als gescheitert betrachten, denn die meisten Prozesse haben sich zerstritten oder sind einfach verlaufen. Ohne revolutionäre Organisation im Hintergrund mussten die Basisinitiativen, sofern sie den Absprung aus der subkulturellen Szene überhaupt geschafft haben, in Sozialarbeit und Handwerkelei oder sogar in kollektive Egoismen (wie die Solidarisch-Gruppen) verfallen.
Überschwängliche Selbstüberschätzung
Ähnliches geschah 1968 während des Zerfalls der antiautoritären Bewegung, weshalb ein Blick zurück lohnt. Einer ihrer Sprecher und Theorieköpfe, Hans-Jürgen Krahl, stemmte sich damals vehement gegen diesen Zerfall und kritisierte die daraus resultierende proletarische Wende scharf. Wie er in der »Dialektik des antiautoritären Bewusstseins« schrieb, hatten sich in der Bewegung, nachdem ihr Scheitern offenkundig war, erhebliche Frustgefühle ausgebreitet. Das Scheitern und den Frust hätte man diskutieren und daraus politische Konsequenzen für die Zukunft ziehen müssen. Krahl forderte die Erkenntnis, dass eine partikulare, vorwiegend studentische Randgruppe das System nicht stürzen könne. Jedoch war die Bewegung zu solchen Schlussfolgerungen nicht in der Lage, weil sie eine ganz überschwängliche Einschätzung ihrer eigenen Aktion hatte: nämlich dass 1968 mehr oder weniger direkt zu einer universalen Emanzipation führen würde.
Stattdessen zerfiel die antiautoritäre Bewegung in sektiererische Kleingruppen. Ein »Kleinkrieg aller gegen alle« brach aus, in dem alle ihre je individuellen Emanzipationsbedürfnisse absolut setzten und gegen die der anderen durchzusetzen versuchten. Schließlich konnte man nicht mal mehr miteinander sprechen. Freiraumideologie, Theoriefeindlichkeit, Aktionsfetischismus machten sich breit. Krahl sah das Totalitätsbewusstsein der Bewegung schwinden, stattdessen sollte eine Utopie unmittelbar im Hier und Jetzt realisiert werden.
Die Bewegung trieb sich damit umso mehr in ihr eigenes Scheitern hinein, das nicht sein durfte, weil die universale Emanzipation unbedingt gelingen musste. Um sich nicht mit der eigenen Schuld am Scheitern auseinandersetzen zu müssen, suchte die Bewegung nach einem Weg, die Unterdrückung nun endlich effektiv und endgültig zu bekämpfen. Ihre Antwort war: hin zum Proletariat und Organisationsaufbau.
Das war allerdings noch nicht die proletarische Wende selbst, also die explizite »Liquidation der antiautoritären Phase«. Der SDS, in dessen Vorstand Krahl war, reagierte zunächst mit einer Organisations- und Strategiedebatte. Genau wie die Kritik der Identitätspolitik der vergangenen Jahre kritisierte diese Debatte die verabsolutierten Emanzipationsegoismen und die Randgruppentheorie und forderte, die Arbeiter*innenklasse zu berücksichtigen. Es folgten wie heute Ansätze von Basisarbeit in den Betrieben, also die berüchtigte revolutionäre Betriebsarbeit der Post-68er.
Was sich um 1968 im Verlauf weniger Jahre vollzogen hat, wiederholt sich heute, unter den Bedingungen der marginalisierten antiautoritären Szene, innerhalb eines guten Jahrzehnts.
Dabei verstrickte sich der SDS allerdings, so Krahls Analyse damals, in eine »verschwiegene Orthodoxie«. Die Kritik des SDS an den Problemen der antiautoritären Bewegung führte also nicht dazu, dass man sich wirklich mit diesen auseinandersetzte, sondern ihr einfach den bolschewistischen Klassenkampf hinzufügte. Der ist jedoch blind gegenüber der antiautoritären Emanzipation. Dieses »objektive Dilemma« manifestierte sich in einer Wiederholung der Bewegungserfahrung, denn die Basisinitiativen verfielen in sektiererische »Handwerkelei« und verabsolutierten ihre jeweiligen Praktiken zum Nonplusultra.
Trotz der neuen, an der Oktoberrevolution orientierten Strategie führte diese »Neuausrichtung« der antiautoritären Bewegung zum gleichen Ergebnis. Die proletarische Wende löste das Dilemma schließlich mit der »Liquidation der antiautoritären Phase«: Sie entschied es nach der orthodoxen Seite.
Strategische Alternative
Was sich um 1968 im Verlauf weniger Jahre vollzogen hat, wiederholt sich heute unter den Bedingungen der marginalisierten antiautoritären Szene innerhalb eines guten Jahrzehnts. Krahls Analyse macht dabei das Missverständnis der heutigen Debatte deutlich, nämlich dass die Neuausrichtung der radikalen Linken antiautoritär sei. Nein: Die Organisations- und Strategiedebatte der letzten Jahre war bereits eine verschwiegene Orthodoxie, sie hatte schon neoleninistisch auf die antiautoritäre Szene reagiert, der Neoleninismus vollzieht diese Wende jetzt nur mehr explizit. Beispielsweise wiederholt das in der Debatte etablierte Konzept der Initiativkräfte unausgesprochen Lenins Avantgarde, denn die »antiautoritären« Initiativkräfte gründen eine Basisgruppe, um das Proletariat zu organisieren und zu revolutionären Positionen zu bringen.
Die strategische Alternative, die Krahl entwickelte, lässt sich formelhaft wie folgt ausdrücken: Weder antiautoritär noch leninistisch und dennoch an die Einsichten beider Lager anknüpfend. Krahls Alternative fordert keinen unbedingten, sofortigen Schluss mit dem jeweils anderen Lager, sondern versucht, die Notwendigkeit dieser linksradikalen Ideologien, aber auch ihren emanzipatorischen Sinn, bewusst zu reflektieren. Daher versucht sie auch nicht, den Widerspruch per Dekret abzuschaffen, sondern produktiv zu machen, indem sie ihn organisiert und in der bewussten Organisation der antiautoritären Emanzipationsprinzipien und des politischen Realitätsprinzips die Aufhebung des beiden zugrundeliegenden kleinbürgerlichen Bewusstseins so antizipiert, dass dieses in der Organisation und durch ihren Kampf einmal völlig überwunden werden könnte.
So in etwa sähe die Organisationsdebatte aus, die wir heute führen müssen. Lasst uns den Organisations-Leninismus nicht ein zweites Mal als Farce wiederholen. Dutzende neue K-Gruppen-Parteisplitter mit ihren autoritativen Hierarchien und maskulinen Führungskadern braucht wirklich niemand.
Eine ausführliche Version dieses Textes, die auch die Krahl’sche Strategie-Alternative für die heutige Debatte aktualisiert, wird Anfang 2023 im Jahrbuch für marxistische Gesellschaftstheorie erscheinen.
