Entwicklung und Profit
Staatliche Wohlfahrtsleistungen sollten von Beginn an soziale Verwerfungen ausgleichen, um politische Ordnungen zu legitimieren
Von Alex Veit
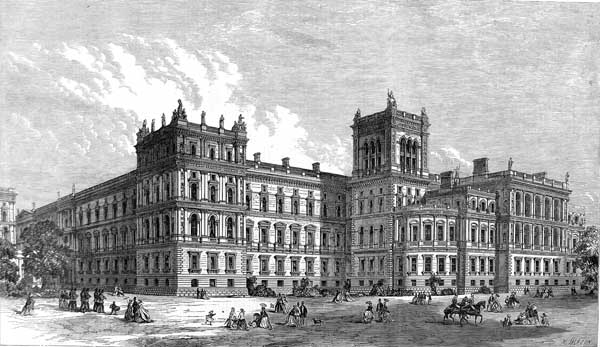
Profite, Wohlfahrt oder Ordnung? Der Zweck von »Entwicklung« als einem staatlichen Projekt war bereits bei der Erfindung des Begriffs umstritten. 1940 beschloss die britische Regierung den »Colonial Development and Welfare Act«. Wie der Historiker Frederick Cooper schreibt, wandte sich das Kolonialministerium in London darin von der Doktrin ab, die einzelnen Kolonialverwaltungen nicht mehr ausgeben zu lassen, als sie von den kolonialen Untertanen selbst eintreiben konnten. Von nun an, so das Versprechen, würde London Mittel für Entwicklung und Wohlfahrt bereitstellen. Mittel- und langfristig, so die offizielle Sprachregelung, würden die Investitionen zu erhöhter Produktivität führen und ein sich selbst tragendes Wirtschaftswachstum in Gang kommen. Die Idee von Entwicklung als einer geplanten profitableren Zukunft war geboren.
Aber reichte das Versprechen zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklung aus, um die Kolonialherrschaft zu legitimieren? An allen Ecken und Enden des British Empire wehrte sich die entstehende Arbeiterklasse in den Minen, Plantagen und Häfen gegen politische Unterdrückung und wirtschaftliche Ausbeutung. Vor allem in Indien wurden die Rufe nach Unabhängigkeit immer lauter. »Wenn wir nichts ziemlich Gutes für das koloniale Empire tun«, notierte der Kolonialminister und Labourpolitiker Malcolm MacDonald, »und etwas, dass ihnen hilft, geeignete soziale Dienste zu bekommen, dann werden wir es verdienen, die Kolonien zu verlieren. Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis wir bekommen, was wir verdienen.« Staatliche Wohlfahrtsleistungen, so das inoffizielle Kalkül, mussten die sozialen Verwerfungen bereits in der Gegenwart ausgleichen, um die politische Ordnung zu legitimieren.
Bei der Umsetzung des Colonial Welfare and Development Act zeichneten sich bereits alle zentralen Aspekte ab, die bis heute in der Diskussion zu Entwicklung und Wohlfahrt im Globalen Süden eine Rolle spielen. Zunächst waren die Zuwendungen aus London viel zu klein, um hinreichende Infrastrukturen oder allgemeine Wohlfahrtssysteme aufzubauen.
Zweitens mussten sich die einzelnen Kolonialverwaltungen um die Mittel bewerben: Entwicklung und Wohlfahrt sollten durch zeitlich begrenzte Projekte angeschoben werden, um die die Bedürftigen konkurrierten. Verlässliche, soziale Sicherungssysteme zeichnen sich aber dadurch aus, dass ihre Finanzierung langfristig gesichert ist. Denn ihr Sinn besteht ja gerade darin, die Unwägbarkeiten der kapitalistischen Produktionsweise zu mildern.
Drittens entsandte London technische Berater, um die Programme und Projekte in den Kolonien umzusetzen. Der Nimbus des angeblichen, universell anwendbaren und mit wissenschaftlicher Methodik legitimierten Wissens erlaubte den Beratern, ihre jeweiligen Vorstellungen durchzusetzen. Bald entstanden daraus sowohl neue wissenschaftliche Disziplinen – beginnend mit der sogenannten Entwicklungsökonomie -, als auch der neue Beruf des Entwicklungsexperten. Dass die abstrakte Expertise den lokalen Gegebenheiten meist unangemessen war, wurde erst durch das Scheitern der Aktivitäten deutlich.
Abstraktes Wissen versus lokale Gegebenheiten
Viertens sollte »Community Development« die unzureichenden materiellen Investitionen kompensieren. In der Vorstellung der Kolonialherren wie vieler Entwicklungsexperten der Gegenwart lebt die Vorstellung eines Dorfes fort, in dem gemeinschaftlich gearbeitet wird und in dem es keine politischen Konflikte gibt. In von informellen Machtstrukturen geprägten »Communities« leisten aber gerade die schwächsten Mitglieder die meiste »freiwillige« Arbeit, während die Bessergestellten am deutlichsten profitieren. Gerade das anscheinend egalitäre Community Development verschärfte die Tendenz zur sozialen Ungleichheit in besonderer Weise, die Entwicklung – im Sinne einer wirtschaftlichen Modernisierung – an sich inhärent ist.
Fünftens waren Entwicklung und Wohlfahrt in den Kolonien (wie in den Metropolen auch) immer eng mit staatlicher Kontrolle und Repression verknüpft. So entwickelten die britischen Kolonialverwaltungen etwa im ostafrikanischen Protektorat Tanganyika (heute: Tansania) ein Meldesystem über Ernteerträge, um Hungersnöten vorbeugen zu können. Es folgten alsbald Vorschriften über durch die »Communities« zu bauende Getreidespeicher und anzupflanzende Nahrungsmittel. Wiederum waren diese Vorgaben nicht immer an lokale Bedürfnisse angepasst, aber der Glaube an die Unwissenheit der Bauern und die Potenziale »moderner« Anbauweisen führten zu ihrer umso resoluteren Durchsetzung.
Zuletzt war das Konzept Entwicklung als Konzept – wie zu Beginn bereits erwähnt – immer größer und weitreichender gedacht als ein reines System sozialer Sicherung. Wirtschaftlich gesehen war das zu erreichende Ziel die Industrialisierung. Gesellschaftlich war eine vollständige Modernisierung aller Lebensbereiche vorgesehen.
Nach dem Ende des Empire
Mit dem Ende des British Empire im Zuge der Dekolonisation ab 1945 übernahmen die einheimischen neuen Eliten in den ehemaligen Kolonien und die internationalen Organisationen und westlichen Entwicklungsorganisationen, mit denen sie zusammenarbeiteten, viele dieser kolonial angelegten Praktiken und Ideen.
Neben der Abschaffung rassistisch begründeter Privilegien und einem antiimperialen Nationalismus versuchten die neuen Machthaber aber durchaus auch, eigene Akzente zu setzen. Tansania etwa setzte auf einen kommunitaristischen Sozialismus, in dem sich wieder Elemente des Community Development mit dem Ziel der Industrialisierung verbanden. Zentrale Versprechen für die staatlich eingeforderten Anstrengungen der Bevölkerung waren erneut soziale Leistungen: kostenlose Gesundheitsversorgung und Grundschulbildung sowie ein verlässlicher Schutz gegen akute Hungersnöte. Tatsächlich investierte die Regierung große Anteile ihres Budgets in diese sozialen Schwerpunkte. Doch als die Bevölkerung zögerte, in sozialistische Dörfer umzusiedeln und neue Formen der Arbeitsteilung zu praktizieren, reagierte die postkoloniale Administration ganz ähnlich wie die kolonialen Vorgänger: mit Zwang und Repression.
Die anschließende Phase der neoliberalen »Strukturanpassung«, die von internationalen Organisationen in den 1980er und 1990er Jahren gegen viele faktisch bankrotte Staaten im Globalen Süden durchgesetzt wurde, verzwergte das Konzept von Entwicklung dann allerdings nachhaltig: Statt einer geplanten grandiosen Zukunft der gesamten Gesellschaft beschränkt sich Entwicklungskooperation auf unzuverlässige und unzureichende Projektförderung für die ärmsten Bevölkerungsteile, die dabei auch noch angehalten wurden, durch Kleinunternehmertum in Eigenverantwortung Wege aus der Misere zu finden. Die sozialen Zusicherungen wurden darauf beschränkt, die Ärmsten vor dem Hungertod zu retten und ihnen sozialen Aufstieg durch Bildung zu ermöglichen. Beide Versprechen wurden zunächst nicht eingehalten. Erst nach massiver Kritik an den Strukturanpassungsprogrammen, auch im Globalen Norden, und zunehmender politischer Instabilität in vielen Ländern des Südens, wurden im Rahmen von Entschuldungsprogrammen und den Millennium Development Goals von 1999 neue Finanzmittel für absolut rudimentäre Sozial- und Bildungsleistungen investiert.
Spätestens mit der Industrialisierung Chinas ist aber gerade auch in Afrika das Konzept einer staatlich geplanten Entwicklung wieder aktuell. So kommt es nun entlang der unterschiedlichen Vorstellungen von Entwicklung zu einer neuen Arbeitsteilung: Die afrikanischen Regierungen lassen sich soziale Leistungen von internationalen Organisationen und Infrastrukturprojekte von China und anderen ostasiatischen Ländern finanzieren. Beide Formen nutzen sie aber weiterhin, um in der Gegenwart Legitimität zu schaffen, Bedürftige zu kontrollieren und im Namen einer besseren Zukunft gesellschaftliche Opfer einzufordern.